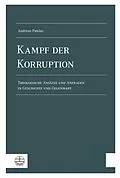Andreas Pawlas, Dr. theol., Jahrgang 1946, studierte Wirtschaftswissenschaften und Theologie in Hamburg und Bethel. Er war als Pastor tätig, als Militärdekan an der Führungsakademie der Bundeswehr/Hamburg sowie als Leiter diakonischer Einrichtungen in Barmstedt. Seit 2001 ist er Gastprofessor an der Theologischen Fakultät in Tartu/Estland und hat Lehraufträge in Kiel und Hamburg.
Autorentext
Andreas Pawlas, Dr. theol., Jahrgang 1946, studierte Wirtschaftswissenschaften und Theologie in Hamburg und Bethel. Er war als Pastor tätig, als Militärdekan an der Führungsakademie der Bundeswehr/Hamburg sowie als Leiter diakonischer Einrichtungen in Barmstedt. Seit 2001 ist er Gastprofessor an der Theologischen Fakultät in Tartu/Estland und hat Lehraufträge in Kiel und Hamburg.
Leseprobe
II DAS PHÄNOMEN DER KORRUPTION NACH POPULÄREN ZEUGEN DER GEGENWART
Lange Zeit war es unvorstellbar, deutsche oder überhaupt westliche Lebenskultur mit Korruption in Verbindung zu bringen. Immerhin hatte Theodor Eschenburg 1959 die Wahrnehmung, dass man in Deutschland »mehr als eineinhalb Jahrhunderte lang durch eine ehrliche öffentliche Verwaltung 'verwöhnt' worden sei«. Namentlich, dass die protestantische Ethik die Beamten davon abgehalten habe, korrupte Praktiken anzuwenden, weshalb andere Klassen es nicht einmal gewagt hätten zu bestechen. So habe der Abstand des öffentlichen Dienstes zu anderen Gruppen der Gesellschaft diesen vor Korruption geschützt. Allerdings fügte Eschenburg auch hinzu, dass sich dies mit der Gründung der Bundesrepublik geändert habe. Sodann wird etwa nicht das vielbeschriebene Phänomen des »Kölner Klüngel«35 breit entfaltet. Vielmehr fährt Eschenburg fort, dass man jetzt nicht nur wirtschaftliche Korruption, sondern auch politische habe.36 Damit beginnt er einen von vielen Autoren fortgesetzten Reigen von Klagen über Korruption, nicht nur in weit entfernten Ländern, sondern unmittelbar in Deutschland selbst,37die in der verächtlichen Bezeichnung »korrupte Republik« kulminieren.38
1 VIEL BEKLAGTE KORRUPTIONSFÄLLE IN DEUTSCHLANDSchaut man in Hinsicht auf Korruptionsskandale in die jüngere Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, so werden von den einschlägig Versierten genügend Beispiele aufgezählt und beklagt: beginnend 1949 mit der »Hauptstadt-Affäre«, fortgesetzt 1958/59 mit der »Leihwagen-Affäre«, 1958 - 1966 mit der HS-30-Affäre, der Affäre um die »Neue Heimat«44, der Flick-Affäre und dem »Kölschen Klüngel«, der Affäre um die Fuchs-Panzer und Airbus-Flugzeuge, die Provisionszahlungen des französischen Mineralölkonzerns Elf Aquitaine beim Kauf von Leuna-Werken und Minol-Tankstellennetz usw.45 Ergänzt wird diese bundesweite Liste gerne um die Namen Siemens46, VW47, AOK48, Trieniken49, Kohl50 und Schröder/Gazprom51 sowie um einige regionale Skandale, wie den um den Berliner TÜV52, die Dresdener Ausländerbehörde53 oder das Frankfurter Straßenbauamt54.
A) DIE FLICK-AFFÄRENach allem, was sich in der Flick-Affäre aufdecken ließ, halten verschiedene sich mit der Korruption befassende Autoren diese für das bis dahin »unangefochtene zentrale Lehrstück in Sachen 'politische Kultur' in der Bundesrepublik«55. In der Affäre scheint deutlich zu werden, wie nachdrücklich und über welch langen Zeitraum ein großes Industrieunternehmen auf verschiedenen Feldern deutscher Politik versucht hatte, durch den Einsatz finanzieller Mittel Einfluss zu gewinnen. Dabei ging es nicht nur darum, für die Friedrich Flick KG und deren Tochtergesellschaften, wie Krauss-Maffei, Feldmühle AG, Maxhütte, Dynamit Nobel, sowie noch ca. 100 weiteren Beteiligungsgesellschaften im In- und Ausland, unmittelbare firmenpolitische Interessen wahrzunehmen, sondern auch »allgemein-industriepolitische Ziele« zu erreichen. Der Konzern setzte 1983 insgesamt ca. 10 Milliarden DM um und beschäftigte ca. 45.000 Mitarbeiter.56
»Vor allem große Wirtschaftsunternehmen in Deutschland haben es stets als ihre Aufgabe angesehen, im gesellschaftlichen und politischen Bereich durch finanzielle Zuwendungen zu helfen. Das gilt im besonderen Maße für den Flick-Konzern.«63
Hierfür sei im Untersuchungszeitraum im Flick-Konzern der persönlich haftende Gesell