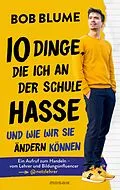Bob Blume ist Lehrer, Blogger, Podcaster und Bildungsinfluencer. Er studierte Germanistik, Anglistik sowie Geschichte und arbeitet nun als Oberstudienrat an einem Gymnasium in der Nähe von Baden-Baden. Daneben schreibt er Fachbücher zum Lernen im digitalen Wandel und macht in den sozialen Medien auf Bildungsthemen aufmerksam. Zudem ist Bob Blume ein gefragter Experte in der deutschen Medienlandschaft zum Thema Schule. Interviews und Beiträge erschienen unter anderem im SWR, dem Deutschlandfunk, im ZDF und bei Zeit online.
Die Welt hat sich verändert die Schule nicht. In diesem Buch prangert Lehrer und Blogger des Jahres Bob Blume zehn Dinge an, die verändert werden müssen, damit die Schule endlich im 21. Jahrhundert ankommt. Denn wir können es uns in einer globalisierten Welt nicht leisten, die wichtigste Ressource, die wir haben, in guter Hoffnung sich selbst zu überlassen. Ob Lehrermangel, Probleme bei der Digitalisierung, Notendruck, nicht mehr zeitgemäße Lehrerausbildung oder überfrachtete Lehrpläne Bob Blume kennt die Probleme an Schulen aus eigener Erfahrung. Er legt die Defizite offen und zeigt Lösungswege auf. Und macht klar: So können wir nicht weitermachen. Wir müssen handeln! Schließlich geht es um die Zukunft unserer Kinder.
Hohe Reichweite: 31.800 Abonnenten auf Instagram, 21.000 Follower auf Twitter und 200.000 Blog-Aufrufe pro Monat.
Autorentext
Bob Blume ist Lehrer, Blogger, Podcaster und Bildungsaktivist. Er studierte Germanistik, Anglistik sowie Geschichte und arbeitet nun als Oberstudienrat an einem Gymnasium in der Nähe von Baden-Baden. Daneben schreibt er Bücher zur Bildungsdebatte und macht in den sozialen Medien als @netzlehrer auf Bildungsthemen aufmerksam. Zudem ist Bob Blume ein gefragter Experte in der deutschen Medienlandschaft zum Thema Schule. Bei der Verleihung der Goldenen Blogger 2022 wurde er als Blogger des Jahres ausgezeichnet. Außerdem wurde er von Bildung.Table, der führenden deutschen Bildungsredaktion, als einer der 100 entscheidenden Köpfe der Bildungsszene ausgewählt.
Leseprobe
2
Unterricht ist erstarrt
Warum ist Unterricht so langweilig?
Erster Vorschlag bei Google
Wenn man bei Google die Wörter »Warum ist Unterricht so ...« eingibt, beendet die Suchmaschine den Satz mit dem Wort, das oben im Zitat zu lesen ist. Das ist also das, was Menschen am meisten, und man darf getrost vermuten, dass es sich dabei um Schüler handelt, wissen wollen. Um herauszufinden, warum Unterricht oft als so langweilig empfunden wird, hat man sich anzuschauen, was genau das eigentlich ist: Unterricht.
Als ich selbst noch Schüler war, war meine Vorstellung davon, was Unterricht ist, sehr naiv. Die Lehrer, so dachte ich, betreten den Klassenraum und wissen, was sie fragen oder sagen müssen. Und dann fragen sie, und man antwortet als Schüler nach bestem Wissen. Oder labert halt rum. So in der Art. Ein solches Bild von Unterricht hatte nicht nur ich, ein solches haben heute immer noch viele: Die Anschauung davon, wie Unterricht funktioniert, was die Lehrer in diesem tun und wie lange eine Stunde dauert, stammt aus einer Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Die immer noch an vielen Schulen bestehende Zeiteinheit von fünfundvierzig Minuten wurde 1911 vom preußischen Kultusminister August von Trott zu Solz eingeführt (um den Nachmittagsunterricht zu kippen, die bisherige Unterrichtszahl aber zu erhalten, wurde einfach jede Stunde um fünfzehn Minuten gekürzt). Innerhalb dieses Zeitrahmens konnte dann der Lehrer sein Wissen den Schülern überstülpen. Die enge Taktung samt Ausrichtung der Klasse auf die vorne stehende Person hat sich bis dato wenig geändert, höchstens an Modellschulen oder neuen Schulformen. Man könnte auch formulieren: Unterricht im 21. Jahrhundert sieht sehr oft noch so aus wie Unterricht im 19. Jahrhundert. Wir bereiten Schüler unter Bedingungen der Vergangenheit auf die Zukunft vor.
Als ich nach dem Lehramtsstudium das erste Mal damit konfrontiert wurde, worum es bei der theoretischen Planung von Unterricht geht, war ich fasziniert und abgestoßen zugleich. Denn diese hatte so gar nichts mit dem zu tun, was ich mir vorgestellt hatte. Unterricht ist in dieser Form eine auf die Minute getaktete Einheit.
Später konnte ich aber auch ganz anderes feststellen. Dass es nämlich immer noch Lehrer gibt, die Unterricht so durchführen, wie in dem dummen Witz zwischen Autodidaktik, Schwellendidaktik und Hammerdidaktik unterschieden wird. Danach ist der Autodidaktiker jemand, der sich im Auto auf dem Weg zur Schule überlegt, was man heute unterrichten könnte. Der Schwellendidaktiker überlegt sich auf dem Weg zum Klassenzimmer, was man machen wird, und entscheidet dies beim Betreten des Raums (bei Überwindung der Türschwelle). Und der Hammerdidaktiker beginnt die Stunde mit der Frage: »Was hamma denn letzte Stunde gemacht?« Haha.
Alle drei Varianten sind Realität und kommen häufiger vor als gedacht, sie sind aber noch kein Unterricht in dem Sinne, wie man ihn in der Fachdidaktik lernt. Wobei eine lockere Diskussion oder ein wenig Spaß sicherlich kein Problem darstellen. Im Gegenteil: Offener und authentischer Austausch kann zu den besten Stunden überhaupt führen. Das größere Problem ist da eher, dass das transportierte Unterrichtsideal, der Kern jeder Lehrerausbildung, so unrealistisch wie starr ist.
Um zu verdeutlichen, warum ich standardisierten Unterricht hasse, muss ich ihn zunächst erklären. Da müssen Sie jetzt durch.
Man könnte sagen, dass es grundsätzlich zwei Versionen von Unterricht gibt. Einmal den, den man im Referendariat durchführen soll. Den guten Unterricht also. Und einmal den Unterricht, den man danach macht. Davon abgesehen gibt es natürlich ungefähr so viele Vorstellungen davon, was guter Unterricht ist, wie es Fachleiter gibt, also jene Leute, die junge Referendare ausbilden. Aber das ist an dieser Stelle zu ignorieren, da man sonst zu ganz anderen Defiziten im deutschen Bildung