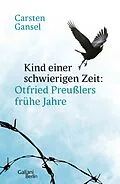Carsten Gansel, Jahrgang 1955, ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik in Gießen. Bei Galiani hat er bereits das von ihm in Russland aufgespürte Manuskript Heinrich Gerlachs Durchbruch bei Stalingrad (2016) sowie dessen Odyssee in Rot (2017) herausgegeben. 2020 erschien mit Wir Selbst von Gerhard Sawatzky eine weitere literarische Entdeckung von Gansel.
Wie das Schreiben beim Überleben hilft die bewegende Lebensgeschichte eines der berühmtesten Kinder- und Jugendbuchautoren. Otfried Preußler war ein deutscher Junge wie viele. Außer, dass er mit 17 anfing zu schreiben. Er kam mit 19 Jahren an die Ostfront und geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Dort rettete er sich nicht zuletzt durch das Schreiben. Was er dort erlebte, wie ihn diese Zeit prägte und welche Kämpfe Otfried Preußler mit sich selbst ausfocht, erzählt Carsten Gansel anhand aufsehenerregender Archivfunde und autobiographischer Texte. Carsten Gansel zeigt, auf welche Weise seine Eltern und die böhmische Landschaft mit ihren Mythen, Sagen und Legenden, und wie Krieg und Gefangenschaft Otfried Preußler prägten und in spätere Werke wie etwa Krabat eingingen. Bei der biografischen Spurensuche hat er zahlreiche Dokumente aus schwer zugänglichen russischen Archiven aufgespürt und gänzlich unbekannte Texte von Otfried Preußler zutage gefördert. Auch Teile eines Jahrzehnte später entstandenen Autobiografie-Projektes und eines unveröffentlichten Romanvorhabens liefern neben unbekannten Gedichten, Briefen, Notizen, Berichten ein eindrucksvolles Bild eines Autors, der wie viele andere seiner Generation auf existenzielle Weise in die Zeitläufte des 20. Jahrhunderts geriet und seinen eigenen Weg fand.
Autorentext
Carsten Gansel, Jahrgang 1955, ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik in Gießen. Bei Galiani hat er bereits das von ihm in Russland aufgespürte Manuskript Heinrich Gerlachs Durchbruch bei Stalingrad (2016) sowie dessen Odyssee in Rot (2017) herausgegeben. 2020 erschien mit Wir Selbst von Gerhard Sawatzky eine weitere literarische Entdeckung von Gansel.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis I. Wohin die Spuren führen
Es begann in der früheren Sowjetunion. Dass ich gerade hier dem Autor Otfried Preußler wiederbegegnen würde, hätte ich nie geahnt - im Russland des 21. Jahrhunderts und in Städten wie Moskau, Kasan und Jelabuga. Persönlich getroffen habe ich Otfried Preußler leider nie, und dies, obwohl ich seit vielen Jahren Gespräche mit Autorinnen und Autoren führe.[18] Wer sich mit Literatur beschäftigt, sollte - so meine Auffassung - auch mit jenen im Austausch stehen, die Urheber dieser einzigartigen Form der Weltaneignung sind. Meine Buchbekanntschaft mit dem Autor Preußler reicht dafür in die 1960er Jahre, und es ist eigentlich eine deutsch-deutsche Geschichte. Denn: Die fantastische Erzählung vom »Kleinen Wassermann«, die Otfried Preußler 1956 den Durchbruch als Autor brachte, fand in einem Paket den Weg in den Osten. »Geschenksendung, keine Handelsware« stand in großen Buchstaben auf der Verpackung.[19] Und ich weiß noch heute, dass mir damals die Episode, in der es zum Streit zwischen dem kleinen Wassermann und dem Menschenmann kommt, am besten gefallen hat. Erst viel später wurde mir klar, dass die gewisse Entgegensetzung von Kinder- und Erwachsenenwelt im »Kleinen Wassermann« romantisch motiviert ist. Schon in Ludwig Tiecks »Die Elfen« (1812) oder auch E.T.A. Hoffmanns »Das fremde Kind« (1817) fungieren die kindlichen Protagonisten als Grenzgänger, die zwei Welten miteinander in Verbindung bringen, eine real-fiktive und eine phantastische. Im Rahmen romantischen Selbstverständnisses wird einzig Kindern die Eigenschaft zugeschrieben, in beiden Welten heimisch zu sein; Kinder sind es, die noch nicht das Rationale favorisieren, sie nehmen das Wunderbare an, sind sensibel und offen gegenüber anders gearteten Wirklichkeitserfahrungen. Genau das findet man auch bei Otfried Preußler.
Jahre später, während des Studiums in den späten 1970er Jahren, fiel erneut der Name Otfried Preußler. Egon Schmidt, Professor für deutsche Literatur, machte ihn in einer speziellen Vorlesung mit der deutschen Kinder- und Jugendliteratur von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt.[20] Dabei ging er mehrfach auch auf die böhmische Literatur für junge Leser ein und stellte Bezüge zur tschechischen her, die zunächst stark aus der Folklore, also der mündlichen Überlieferung, gespeist wurde. Wir wunderten uns, woher seine Kenntnisse im Tschechischen kamen, dann deutete Egon Schmidt nebenher irgendwann an, dass er in Nordböhmen geboren worden war. Durchaus mit etwas Stolz in der Stimme verwies er, der selbst erfolgreich Kinderbücher schrieb, auf die böhmischen Märchen und Sagen und darauf, dass Böhmen allem Anschein nach eine Region sei, die die schriftstellerische Phantasie in besonderer Weise anregen würde. Und er nannte auch zwei Namen: Franz Fühmann und Otfried Preußler. Fühmann war in der DDR eine anerkannte literarische Größe, aber Otfried Preußler aus Westdeutschland kannten nur wenige. Ich gehörte zu denen, die mit seinem Namen etwas anfangen konnten, denn auch der »Räuber Hotzenplotz«, dessen erster Band 1961 erschien, hatte es über die innerdeutsche Grenze geschafft. Das Buch wurde - wie man damals sagte - »vergesellschaftet«, also vielfach ausgeliehen. Ich weiß noch ganz genau, wie penibel ich den Freunden einschärfte, pflegsam mit dem Buch umzugehen.
Egon Schmidt, Jahrgang 1927, übrigens stammte aus Klein Priesen, dem heutigen Malé Brezno, etwa 150 Kilometer von Reichenberg (Liberec) entfernt, dem Ort, wo Otfried Preußler geboren wurde. Daher Schmidts ausgezeichneten Kenntnisse der böhmischen und tschechischen Literatur.
Einige Jahre später führte mich ein eher trauriger Anlass erneut in die Wohnung der Familie Schmidt. Mein früherer Lehrer war verstorben, und seine Frau wollte eine kleine