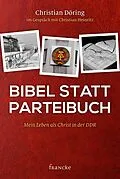Wie war das Leben damals in der DDR als Christ? Fragt man zehn Menschen, wird man zehn unterschiedliche Antworten bekommen. Meiner Meinung nach sollten wir voneinander wissen, was früher war, vor allem deshalb habe ich 25 Geschichten zum 25. Jahrestag des Mauerfalls aufgeschrieben. Christian Döring Mit seinen 25 selbst erlebten, authentischen Geschichten wirft Christian Döring 25 Schlaglichter auf die ganz besonderen Umstände, die den Alltag eines DDR-Bürgers bestimmten. Er stellt sich den Fragen von Christian Heinritz, einem gleichaltrigen Westler, und gewährt tiefe Einblicke in sein Aufwachsen und Leben als Christ in der DDR. Für die, die erlebt haben, was es heißt, als politisch Unzuverlässiger in einem sozialistischen Staat zu leben, holen sie das entsprechende Lebensgefühl aus der immer stärker hereinbrechenden Dämmerung des Vergessens und helfen ein kleines Stück weit, selbst Erlebtes zu verarbeiten. Für die, die im Westen aufgewachsen sind, eröffnen sie ein Universum ebenso unbekannter wie spannender Erfahrungen, die helfen, die jüngste deutsche Geschichte besser zu verstehen. Christian Döring nimmt uns alle mit auf eine faszinierende Reise in die Vergangenheit.
Autorentext
Leseprobe
1. Die Teilung der Welt Herr Döring ist das nicht schade? Vor zwei Jahren hätten wir vielleicht mit einem Glas Rotkäppchensekt so schön auf Ihr Doppeljubiläum anstoßen können: 25 Jahre Mauerfall und 50 Jahre Christian Döring. Dummerweise aber hat Herr Honecker die dafür notwendige, rechtzeitige Öffnung der innerdeutschen Grenze im Jahr 1987 verbaselt und uns diese Freude genommen. Aber wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben und der Staatsratsvorsitzende musste ja dann die Folgen seines Starrsinns tragen. Das hilft Ihnen aber auch nicht viel weiter, denn ich kann mir vorstellen, dass Sie gerne verzichtet hätten auf diese unfreiwillige Verlängerung die letzten 24 Monate DDR bis zum November 1989. 25 Jahre Sozialismus, 27 Jahre als Christ leben unter den Restriktionen eines atheistischen Staates, das hat Ihnen am Ende sicher gereicht. Leider muss ich Sie enttäuschen, Herr Heinritz. Zumindest im Abstand von nun 25 Jahren bin ich ganz zufrieden damit, dass ich die letzten beiden Jahre in der DDR erleben durfte. Ich habe das Wunder der Wiedervereinigung von innen miterleben, mitgestalten und bestaunen dürfen, und das war mein bisher größtes Erlebnis. Wie aber hat alles angefangen? Wo wurden Sie hineingeboren in dieses Arbeiterparadies? Und von wem? Am Totensonntag 1962 wurde ich im Güstrower Schlosskrankenhaus geboren. Kein freudiges Ereignis. Mein Großvater war ziemlich verärgert darüber. Bessarabier sind halt nicht nur fromme Leute, sondern hin und wieder auch ein wenig abergläubisch. Seine Befürchtung war: Wer am Totensonntag geboren wird, der lebt nicht lange. Und tatsächlich wurde ich bereits nach drei Lebenstagen krank. Aufgrund einer schweren Ernährungsstörung nahm ich nicht zu, sondern ab, und das ist lebensgefährlich, jedenfalls bei einem Säugling. Anfang der 60er-Jahre wurden diese in ganz Deutschland nicht nach deren Hungerschrei, sondern nach Uhrzeit gefüttert. Aber ich war schon damals ein so sturer Mecklenburger, dass ich mich nicht nach der Uhrzeit richtete. Wenn ich meiner Mutter im Krankenhaus zum Stillen gebracht wurde, schlief ich tief und fest. War die Stillzeit dann um und ich schlief immer noch, hatte ich halt Pech gehabt. Und so schleppten mich meine Mutter und meine Patentante an meinem dritten Lebenstag zur Nottaufe in den Dom zu Güstrow. Irgendwie schlug ich dem Aberglauben dann aber doch ein Schnippchen und die Nahrung gelangte nach der Taufe in regelmäßigen Abständen in mich hinein. An meinem zehnten Lebenstag wurde meine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen und ich zog ins Güstrower Kinderheim ein. Mein Vater hatte nämlich eine offene Lungentuberkulose und durfte aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht in engeren Kontakt mit mir kommen. Er durfte mich noch nicht einmal berühren. Das war sehr schwer für ihn. Jedes Wochenende kamen meine Eltern ins Kinderheim, um mich zu besuchen. Eine Stunde lang war Besuchszeit. Hatte die liebe Tante Sissi Dienst, brachte sie mich einen Augenblick hinter eine große Glaswand im Treppenhaus, damit mein Vater mich zumindest kurz sehen konnte. Hatte allerdings die ungeliebte Blabla Dienst, bekam mein Vater mich nicht zu sehen, denn Säuglinge durften das Säuglingszimmer eigentlich nicht verlassen. Ungeliebt war diese Tante bei mir, weil sie später nicht mit Klapsen auf meinen Hintern sparte. An einem Wochenende, als ich etwas über ein Jahr alt war, hatte wieder Blabla Dienst, als meine Eltern mich besuchten. Mein Vater machte ihr klar, dass er ein letztes Mal mitgekommen war. Seine Ärzte hatten ihn aufgegeben. Mit den Worten: Wenn Sie mich heute nicht zu meinem Sohn lassen, dann schlage ich Ihnen die riesige Glaswand im Treppenhaus kaputt, versuchte er mich wenigstens einmal in den Arm zu bekommen. Schwester Bärbel bekam Angst und lief weg. Für meinen Vater war der Weg frei. Meine Mutter zeigte ihm den Weg ins Säuglingszimmer. Er nahm mich auf seine Arme und gab mir einen ersten Kuss. Ich war damals 15 Monate alt. Dies war auch der letzte Kuss. Zwei Wochen später war er tot. Damit durfte ich nach Hause. Dieses war in der mecklenburgischen Warnowstadt Schwaan. Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche, in die es hineinregnete, waren unser Zuhause. Meine Mutter war damals in einem Krankenhaus als Krankenschwester tätig und musste natürlich abwechselnd in Tag- und Nachtschichten arbeiten. Aber der real existierende sozialistische Arbeiter- und Bauernstaat hatte vorgesorgt. Es gab die sogenannten Wochenkrippen. Da wurden die lieben Kleinen montags um 6 Uhr abgeliefert und durften freitags ab 17 Uhr wieder abgeholt werden. Lange hielt meine Mutter diese wöchentlichen Trennungszeiten aber nicht aus. Als ich drei Jahre alt war, wurde in unserer Kleinstadt ein dritter Kindergarten gebaut. Mit drei durfte man so eine sozialistische Bildungseinrichtung besuchen. Meine Mutter sattelte um. Aus der Krankenschwester wurde eine Hilfsköchin. Später, als sie bereits 50 Jahre alt war, machte sie ihren Facharbeiter, weil dies über 100 Mark mehr in der Lohntüte ausmachte. So gingen wir beide täglich morgens um 6.30 Uhr in den Kindergarten. Ich in meine Gruppe und meine Mutter in ihre Küche. Monatlich fehlte ich an nur einem einzigen Tag. Meine Mutter nahm dann ihren Haushaltstag und brachte es nicht übers Herz, mich an ihrem freien Tag in den Kindergarten zu schaffen. Der Haushaltstag war sozusagen ein zusätzlicher bezahlter Urlaubstag im Monat, den der Arbeitnehmer vorrangig die Frauen, aber auch alleinerziehende Männer nehmen konnte, um sich um Haushaltsdinge oder Familienangelegenheiten zu kümmern. Wir wohnten zehn Minuten Fußweg von meinem Kindergarten entfernt. Dieser lag mitten in einem soeben entstandenen sozialistischen Wohngebiet. Weil der letzte Parteitag der SED in Berlin es einstimmig beschlossen hatte, wurden zügig überall zwischen Rostock-Warnemünde und Suhl Wohngebiete in Form von schnell zu errichtenden Plattenbauten aufgebaut. Wir aber lebten weiterhin in einer kleinen Altbauwohnung ohne Kinderzimmer, Toilette und Bad für 20 Mark Monatsmiete. Diese war in keinem sonderlich guten Zustand. Das Fensterholz war zum Beispiel so morsch wenn man da angefangen hat, mit dem Fingernagel dran zu puhlen, konnte es gut sein, dass man kurz darauf durch ein Loch ins Freie sehen konnte. Ich erinnere mich noch daran, dass einige Fensterflügel einfach zugenagelt waren, weil keine Haken zum Einhängen der Flügel mehr vorhanden waren und es keine neuen zu kaufen gab. Genauso wie es oftmals über Monate kein Klopapier zu kaufen gab. So habe ich mir bereits als Kind meinen Po mit de…
Autorentext
Christian Döring wurde 1962 in Güstrow in der DDR geboren. Er ist verheiratet und hat fünf Kinder. Heute rezensiert er vor allem christliche Literatur für seinen Bücherblog "bücherändernleben".
Leseprobe
1. Die Teilung der Welt Herr Döring ist das nicht schade? Vor zwei Jahren hätten wir vielleicht mit einem Glas Rotkäppchensekt so schön auf Ihr Doppeljubiläum anstoßen können: 25 Jahre Mauerfall und 50 Jahre Christian Döring. Dummerweise aber hat Herr Honecker die dafür notwendige, rechtzeitige Öffnung der innerdeutschen Grenze im Jahr 1987 verbaselt und uns diese Freude genommen. Aber wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben und der Staatsratsvorsitzende musste ja dann die Folgen seines Starrsinns tragen. Das hilft Ihnen aber auch nicht viel weiter, denn ich kann mir vorstellen, dass Sie gerne verzichtet hätten auf diese unfreiwillige Verlängerung die letzten 24 Monate DDR bis zum November 1989. 25 Jahre Sozialismus, 27 Jahre als Christ leben unter den Restriktionen eines atheistischen Staates, das hat Ihnen am Ende sicher gereicht. Leider muss ich Sie enttäuschen, Herr Heinritz. Zumindest im Abstand von nun 25 Jahren bin ich ganz zufrieden damit, dass ich die letzten beiden Jahre in der DDR erleben durfte. Ich habe das Wunder der Wiedervereinigung von innen miterleben, mitgestalten und bestaunen dürfen, und das war mein bisher größtes Erlebnis. Wie aber hat alles angefangen? Wo wurden Sie hineingeboren in dieses Arbeiterparadies? Und von wem? Am Totensonntag 1962 wurde ich im Güstrower Schlosskrankenhaus geboren. Kein freudiges Ereignis. Mein Großvater war ziemlich verärgert darüber. Bessarabier sind halt nicht nur fromme Leute, sondern hin und wieder auch ein wenig abergläubisch. Seine Befürchtung war: Wer am Totensonntag geboren wird, der lebt nicht lange. Und tatsächlich wurde ich bereits nach drei Lebenstagen krank. Aufgrund einer schweren Ernährungsstörung nahm ich nicht zu, sondern ab, und das ist lebensgefährlich, jedenfalls bei einem Säugling. Anfang der 60er-Jahre wurden diese in ganz Deutschland nicht nach deren Hungerschrei, sondern nach Uhrzeit gefüttert. Aber ich war schon damals ein so sturer Mecklenburger, dass ich mich nicht nach der Uhrzeit richtete. Wenn ich meiner Mutter im Krankenhaus zum Stillen gebracht wurde, schlief ich tief und fest. War die Stillzeit dann um und ich schlief immer noch, hatte ich halt Pech gehabt. Und so schleppten mich meine Mutter und meine Patentante an meinem dritten Lebenstag zur Nottaufe in den Dom zu Güstrow. Irgendwie schlug ich dem Aberglauben dann aber doch ein Schnippchen und die Nahrung gelangte nach der Taufe in regelmäßigen Abständen in mich hinein. An meinem zehnten Lebenstag wurde meine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen und ich zog ins Güstrower Kinderheim ein. Mein Vater hatte nämlich eine offene Lungentuberkulose und durfte aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht in engeren Kontakt mit mir kommen. Er durfte mich noch nicht einmal berühren. Das war sehr schwer für ihn. Jedes Wochenende kamen meine Eltern ins Kinderheim, um mich zu besuchen. Eine Stunde lang war Besuchszeit. Hatte die liebe Tante Sissi Dienst, brachte sie mich einen Augenblick hinter eine große Glaswand im Treppenhaus, damit mein Vater mich zumindest kurz sehen konnte. Hatte allerdings die ungeliebte Blabla Dienst, bekam mein Vater mich nicht zu sehen, denn Säuglinge durften das Säuglingszimmer eigentlich nicht verlassen. Ungeliebt war diese Tante bei mir, weil sie später nicht mit Klapsen auf meinen Hintern sparte. An einem Wochenende, als ich etwas über ein Jahr alt war, hatte wieder Blabla Dienst, als meine Eltern mich besuchten. Mein Vater machte ihr klar, dass er ein letztes Mal mitgekommen war. Seine Ärzte hatten ihn aufgegeben. Mit den Worten: Wenn Sie mich heute nicht zu meinem Sohn lassen, dann schlage ich Ihnen die riesige Glaswand im Treppenhaus kaputt, versuchte er mich wenigstens einmal in den Arm zu bekommen. Schwester Bärbel bekam Angst und lief weg. Für meinen Vater war der Weg frei. Meine Mutter zeigte ihm den Weg ins Säuglingszimmer. Er nahm mich auf seine Arme und gab mir einen ersten Kuss. Ich war damals 15 Monate alt. Dies war auch der letzte Kuss. Zwei Wochen später war er tot. Damit durfte ich nach Hause. Dieses war in der mecklenburgischen Warnowstadt Schwaan. Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche, in die es hineinregnete, waren unser Zuhause. Meine Mutter war damals in einem Krankenhaus als Krankenschwester tätig und musste natürlich abwechselnd in Tag- und Nachtschichten arbeiten. Aber der real existierende sozialistische Arbeiter- und Bauernstaat hatte vorgesorgt. Es gab die sogenannten Wochenkrippen. Da wurden die lieben Kleinen montags um 6 Uhr abgeliefert und durften freitags ab 17 Uhr wieder abgeholt werden. Lange hielt meine Mutter diese wöchentlichen Trennungszeiten aber nicht aus. Als ich drei Jahre alt war, wurde in unserer Kleinstadt ein dritter Kindergarten gebaut. Mit drei durfte man so eine sozialistische Bildungseinrichtung besuchen. Meine Mutter sattelte um. Aus der Krankenschwester wurde eine Hilfsköchin. Später, als sie bereits 50 Jahre alt war, machte sie ihren Facharbeiter, weil dies über 100 Mark mehr in der Lohntüte ausmachte. So gingen wir beide täglich morgens um 6.30 Uhr in den Kindergarten. Ich in meine Gruppe und meine Mutter in ihre Küche. Monatlich fehlte ich an nur einem einzigen Tag. Meine Mutter nahm dann ihren Haushaltstag und brachte es nicht übers Herz, mich an ihrem freien Tag in den Kindergarten zu schaffen. Der Haushaltstag war sozusagen ein zusätzlicher bezahlter Urlaubstag im Monat, den der Arbeitnehmer vorrangig die Frauen, aber auch alleinerziehende Männer nehmen konnte, um sich um Haushaltsdinge oder Familienangelegenheiten zu kümmern. Wir wohnten zehn Minuten Fußweg von meinem Kindergarten entfernt. Dieser lag mitten in einem soeben entstandenen sozialistischen Wohngebiet. Weil der letzte Parteitag der SED in Berlin es einstimmig beschlossen hatte, wurden zügig überall zwischen Rostock-Warnemünde und Suhl Wohngebiete in Form von schnell zu errichtenden Plattenbauten aufgebaut. Wir aber lebten weiterhin in einer kleinen Altbauwohnung ohne Kinderzimmer, Toilette und Bad für 20 Mark Monatsmiete. Diese war in keinem sonderlich guten Zustand. Das Fensterholz war zum Beispiel so morsch wenn man da angefangen hat, mit dem Fingernagel dran zu puhlen, konnte es gut sein, dass man kurz darauf durch ein Loch ins Freie sehen konnte. Ich erinnere mich noch daran, dass einige Fensterflügel einfach zugenagelt waren, weil keine Haken zum Einhängen der Flügel mehr vorhanden waren und es keine neuen zu kaufen gab. Genauso wie es oftmals über Monate kein Klopapier zu kaufen gab. So habe ich mir bereits als Kind meinen Po mit de…
Titel
Bibel statt Parteibuch
Untertitel
Mein Leben als Christ in der DDR
Autor
andere
EAN
9783868278637
ISBN
978-3-86827-863-7
Format
E-Book (epub)
Hersteller
Herausgeber
Genre
Veröffentlichung
01.09.2014
Digitaler Kopierschutz
frei
Dateigrösse
0.86 MB
Anzahl Seiten
160
Jahr
2014
Untertitel
Deutsch
Auflage
1., Auflage
Lesemotiv
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.