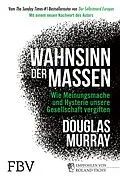Douglas Murray ist Mit-Herausgeber des »Spectator« und schreibt regelmäßig für eine Reihe weiterer Publikationen wie die »Sunday Times«, »Standpoint«, »The Guardian« und das »Wall Street Journal«. Er besuchte das Eton College in Eton (Berkshire) und das Magdalen College an der Universität von Oxford. Murray wurde mit dem Charles-Douglas-Home-Gedenkpreis für Journalismus ausgezeichnet und war als Gastredner bereits zu Gast im Britischen sowie Europäischen Parlament und im Weißen Haus. Sein 2017 erschienenes Buch »Der Selbstmord-Europas« führte die Sunday-Times-Bestsellerliste an und war ein internationaler Verkaufserfolg mit starkem Medienecho.
Autorentext
Douglas Murray ist Mit-Herausgeber des »Spectator« und schreibt regelmäßig für eine Reihe weiterer Publikationen wie die »Sunday Times«, »Standpoint«, »The Guardian« und das »Wall Street Journal«. Er besuchte das Eton College in Eton (Berkshire) und das Magdalen College an der Universität von Oxford. Murray wurde mit dem Charles-Douglas-Home-Gedenkpreis für Journalismus ausgezeichnet und war als Gastredner bereits zu Gast im Britischen sowie Europäischen Parlament und im Weißen Haus. Sein 2017 erschienenes Buch »Der Selbstmord-Europas« führte die Sunday-Times-Bestsellerliste an und war ein internationaler Verkaufserfolg mit starkem Medienecho.
Leseprobe
VORWORT
Wir befinden uns inmitten einer großen Verwirrung der Massen. Privat wie öffentlich, online wie offline verhalten sich Menschen zunehmend irrational, emotional, herdenartig und schlicht unangenehm. Die Nachrichten berichten immer wieder von den Folgen eines solchen Verhaltens. Erstaunlicherweise sehen wir zwar die Symptome, nicht aber die Ursachen.
Es kursieren verschiedene Erklärungen dieses Phänomens, die allesamt den Schluss nahelegen, dass dieses Chaos maßgeblich durch den Ausgang einer Präsidentschaftswahl (in den Vereinigten Staaten) oder einer Volksabstimmung (im Vereinigten Königreich) verursacht sei. Doch keine dieser Erklärungen erfasst das eigentliche Problem. Hinter diesen alltäglichen Ereignissen stecken größere Bewegungen und weitreichendere Geschehnisse. Es ist an der Zeit, sich genauer anzusehen, weshalb zurzeit einiges schiefläuft.
Auch die Ursache dieses Zustandes wird nur selten erkannt. Das liegt an der einfachen Tatsache, dass in einem Zeitraum von knapp drei Jahrzehnten alle unsere großen Narrative in sich zusammengefallen sind. Eines nach dem anderen wurde angefochten, es zu verteidigen wurde unpopulär oder unmöglich, es aufrechtzuerhalten. Seit dem 19. Jahrhundert genügten uns religiöse Erklärungen unserer Existenz nicht mehr, und im 20. Jahrhundert ereilten auch die weltlichen Hoffnungen, die die politischen Ideologien angeboten hatten, dieses Schicksal. Das ausgehende 20. Jahrhundert sah den Beginn der Postmoderne, eine Epoche, die sich selbst definiert und definiert wird durch eine große Skepsis gegenüber allen großen Erzählungen.1 Doch wie bereits Schulkinder lernen, verabscheut die Natur das Vakuum, und im Vakuum der Postmoderne begannen sich neue Ideen herauszukristallisieren, mit der Absicht, Erklärungen und Deutungen ganz eigener Art anzubieten.
Es war unvermeidlich, die entstandene Leere erneut zu füllen. Die Menschen der wohlhabenden westlichen Demokratien unserer Zeit konnten unmöglich die ersten in der Geschichte der Menschheit sein, die keinerlei Erklärung dafür fänden, was wir hier tun, und keine Erzählung hätten, die ihrem Leben Sinn verleiht. Was immer den großen Erzählungen der Vergangenheit auch gefehlt hat, so gaben sie doch dem Leben eine Bedeutung. Die Frage, was genau wir eigentlich mit unserem Leben anfangen sollen - außer Reichtümer anzuhäufen, wann immer es geht, und jedem erdenklichen Vergnügen nachzugehen, das sich uns bietet -, musste irgendwie beantwortet werden.
Seit ein paar Jahren zeichnet sich ab, dass die Antwort lauten könnte, sich an neuen Schlachten und immer wilderen Aktionen zu beteiligen und immer abseitigere Forderungen zu stellen. Sinn und Bedeutung scheinen darin zu liegen, einen Dauerkrieg gegen jeden zu führen, der auf der falschen Seite zu stehen scheint, obwohl die einer Auseinandersetzung zugrunde liegende Frage möglicherweise nur neu gedeutet und die Antwort darauf nur neu formuliert wurde. Die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der sich diese Entwicklung vollzog, lässt sich nicht nur damit erklären, dass eine Handvoll Unternehmen aus dem Silicon Valley (vornehmlich Google, Twitter und Facebook) in der Lage sind zu steuern, was ein Großteil der Menschen auf dieser Welt weiß, denkt und äußert, sondern auch mit ihrem Geschäftsmodell, das - so wurde es einmal trefflich formuliert - darauf beruht, »Kunden zu finden, die bereit sind, Geld dafür zu zahlen, dass sie das Verhalten Dritter beeinflussen können«.2 Erschwerend kommt hinzu, dass die modernen Technologien so rasend schnell sind, dass wir kaum noch mit ihnen Schritt halten können. Dennoch werden diese Kriege nicht grundlos geführt. Sie alle weisen in eine bestimmte Richtung. Und diese Richtung verfolgt ein ungeheures Ziel. Ziel ist es - manchen Menschen dürfte es bewusst sein, anderen dagegen nicht -, eine neue Metaphysik in unserer Gesellschaft zu verankern: eine neue Religion, wenn Sie so wollen.