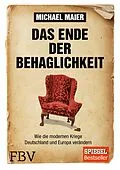Deutschland spürt das Ende der Behaglichkeit Hunderttausende Flüchtlinge suchen Schutz in Europa. Die EU scheint zu zerfallen. Die Ikone Volkswagen wankt. Ein Kalter Krieg gegen Russland ist plötzlich denkbar. Das Unbehagen der Bürger steigt: Woher kommt all das Chaos? Die Flüchtlinge sind die ersten sichtbaren Zeugen für die globale Dimension des Umbruchs. Nach Jahrzehnten des Friedens werden auch wir von den modernen Kriegen eingeholt, die rund um uns toben. Diese modernen Kriege nützen die Möglichkeiten der technologisch-industriellen Revolution und sind daher besonders effizient. Waffen werden nicht mehr von Soldaten bedient, sondern von Computerspezialisten. Söldner kämpfen anstelle regulärer Armeen. Finanzkrieger und Spekulanten machen Jagd auf die Sparguthaben und den Sozialstaat. Die Königsdisziplin ist der Cyber-Krieg: Stromversorgung, Krankenhäuser, Telefonnetze sind anfällig für Attacken. In den Medien toben Propaganda-Schlachten. Das Merkmal der modernen Kriege: Wir wissen nicht mehr, wer ist Feind, wer Freund. Deutschland und Europa sind nicht gewappnet. Die Eliten haben sich in den vergangenen Jahren hauptsächlich um die Absicherung ihres persönlichen Status Quo gekümmert. Diese Haltung kann uns zum Verhängnis werden - denn die technologisch-industrielle Revolution hat nicht vor, an unseren Grenzen Halt zu machen. Deutschland ist gezwungen, sich selbst neu zu erfinden. Jetzt geht es darum, die Veränderung zu gestalten - oder von ihr überrollt zu werden.
Michael Maier ist Herausgeber der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Nach seinem Jurastudium in Graz war er Wirtschaftsleiter des Afro-Asiatischen Instituts in Graz, danach Chefredakteur der Presse (Wien) und Kolumnist beim Standard (Wien) sowie Chefredakteur der Berliner Zeitung, des Stern und der Netzeitung. Er war Fellow am Shorenstein Center der Harvard Kennedy School for Government (Forschungsthema: Umweltschutz und Bürgerjournalismus) sowie Gast am Koebner Institut für Neue Deutsche Geschichte der Hebräischen Universität Jerusalem (Professor Moshe Zimmerman), wo er über Antisemitismus in der DDR forschte.
Autorentext
Zusammenfassung
Deutschland spürt das Ende der BehaglichkeitHunderttausende Flüchtlinge suchen Schutz in Europa. Die EU scheint zu zerfallen. Die Ikone Volkswagen wankt. Ein Kalter Krieg gegen Russland ist plötzlich denkbar. Das Unbehagen der Bürger steigt: Woher kommt all das Chaos? Die Flüchtlinge sind die ersten sichtbaren Zeugen für die globale Dimension des Umbruchs. Nach Jahrzehnten des Friedens werden auch wir von den modernen Kriegen eingeholt, die rund um uns toben.Diese modernen Kriege nützen die Möglichkeiten der technologisch-industriellen Revolution und sind daher besonders effizient. Waffen werden nicht mehr von Soldaten bedient, sondern von Computerspezialisten. Söldner kämpfen anstelle regulärer Armeen. Finanzkrieger und Spekulanten machen Jagd auf die Sparguthaben und den Sozialstaat. Die Königsdisziplin ist der Cyber-Krieg: Stromversorgung, Krankenhäuser, Telefonnetze sind anfällig für Attacken. In den Medien toben Propaganda-Schlachten. Das Merkmal der modernen Kriege: Wir wissen nicht mehr, wer ist Feind, wer Freund.Deutschland und Europa sind nicht gewappnet. Die Eliten haben sich in den vergangenen Jahren hauptsächlich um die Absicherung ihres persönlichen Status Quo gekümmert. Diese Haltung kann uns zum Verhängnis werden denn die technologisch-industrielle Revolution hat nicht vor, an unseren Grenzen Halt zu machen. Deutschland ist gezwungen, sich selbst neu zu erfinden. Jetzt geht es darum, die Veränderung zu gestalten oder von ihr überrollt zu werden.
Leseprobe
Einleitung
Als ich im Jahr 1996 von Wien nach Berlin geholt wurde, um aus dem ehemaligen SED-Bezirksblatt "Berliner Zeitung" eine ordentliche Zeitung zu machen, war Deutschland für viele europäische Einwanderer die ideale Mischung von Behaglichkeit und Aufbruch. Man konnte viel erleben, ohne etwas zu riskieren. Die Wiedervereinigung war zwar ein radikaler Bruch, traf aber in erster Linie die Ostdeutschen. Den westdeutschen Eliten bot sich die einmalige Chance einer Zeitreise in die Vergangenheit. So verließen junge, neugierige und außerordentlich belesene Journalisten die behaglichen Redaktionsräume der FAZ, um für ein ehemaliges SED-Propagandablatt die Überreste der DDR zu bestaunen. Sie notierten die Aussagen von müden Helden und eloquenten Verrätern, porträtierten die Zeitzeugen und spotteten über die Spießigkeit der Diktatoren von Wandlitz. In meist brillanten Texten gelang es ihnen, von Goethe bis zur Love Parade immer die richtige historische Reminiszenz zu finden.
Überlegungen, welche Folgen die friedliche Revolution von 1989 für das Deutschland der Zukunft haben würde, standen für die meisten nicht im Vordergrund. Die DDR-Bürgerrechtler spielten keine Rolle. Bärbel Bohley, eine Art Jeanne d'Arc des Mauerfalls, lebte immer noch in ihrer verfallenen Wohnung am Prenzlauer Berg. Später ging sie nach Bosnien, um dem Land beim Wiederaufbau nach dem Krieg zu helfen. Die politischen Macher setzten auf einen wilden Bauboom. Der Alexanderplatz, wo die Redaktion liegt, sollte eine Skyline aus Wolkenkratzern erhalten, vor der selbst New York erblassen würde. Zwanzig Jahre später sieht der Platz immer noch aus wie zu Mielkes Zeiten. Nur die Ost-Kneipe "Das Setz-Ei" hat Pleite gemacht und ist verschwunden. Der DDR-Vorzeigebau, der "Palast der Republik", wurde abgerissen. An dem Ort wird das kaiserliche Stadtschloss rekonstruiert.
Warum hat "die Wende" eigentlich keinen Modernisierungsschub in Deutschland ausgelöst? Die deutschen Eliten haben damals vor allem leidenschaftlich darüber gestritten, welche Folgen die Wiedervereinigung für die Vergangenheit Deutschlands haben würde. Die Zukunft sollte aus der Vergangenheit definiert werden. Ich erinnere mich an nächtelange hitzige Diskussionen mit dem Direktor des Deutschen Historischen Museums in Berlin: Es ging um die Frage, ob die Quadriga vom Brandenburger Tor aus heraldischer Sicht als neues Symbol für die "Berliner Zeitung" taugen könnte, oder das als eine Reminiszenz an Preußen missverstanden werden würde. Wir verwarfen die Idee und entschieden uns für die Modernisierung der Zeitung.
Ich gewann damals den Eindruck, dass die deutschen Eliten eine gewisse Aversion gegen wirklich radikale Veränderungen haben. Unberechenbare Erneuerer werden misstrauisch beäugt. Man fürchtet den radikalen Bruch. Deutschland setzt auf die Perfektion des Bestehenden. Bei neuen Dingen will man erst mal abwarten, ob sie sich bewähren. Wenn allerdings einmal eine Neuerung vollzogen wurde, dann können sich die Deutschen wie kein anderes Volk der Welt an der "inkrementellen Verbesserung" erfreuen: Hier noch ein Schräubchen, da ein Rädchen, dort eine Stellschraube - so wird man Export-Weltmeister.
Doch schon um das Jahr 2000 zeigte sich auch in Deutschland, dass die nächste Umwälzung nicht so einfach zu absorbieren sein würde: Die Internet-Revolution machte die Wiedervereinigung über Nacht zu einer welthistorischen Petitesse. In Amerika legte der russische Einwanderer Sergey Mikhaylovich Brin den Grundstein zu einem neuen Imperium. Google sollte nur wenige Jahre später zu einer Macht werden, die im Zusammenspiel mit anderen Technologie-Gigant…
Michael Maier ist Herausgeber der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Nach seinem Jurastudium in Graz war er Wirtschaftsleiter des Afro-Asiatischen Instituts in Graz, danach Chefredakteur der Presse (Wien) und Kolumnist beim Standard (Wien) sowie Chefredakteur der Berliner Zeitung, des Stern und der Netzeitung. Er war Fellow am Shorenstein Center der Harvard Kennedy School for Government (Forschungsthema: Umweltschutz und Bürgerjournalismus) sowie Gast am Koebner Institut für Neue Deutsche Geschichte der Hebräischen Universität Jerusalem (Professor Moshe Zimmerman), wo er über Antisemitismus in der DDR forschte.
Autorentext
Michael Maier war Herausgeber der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Nach seinem Jurastudium in Graz war er Wirtschaftsleiter des Afro-Asiatischen Instituts in Graz, danach Chefredakteur der Presse (Wien) und Kolumnist beim Standard (Wien) sowie Chefredakteur der Berliner Zeitung, des Stern und der Netzeitung. Er war Fellow am Shorenstein Center der Harvard Kennedy School for Government (Forschungsthema: Umweltschutz und Bürgerjournalismus) sowie Gast am Koebner Institut für Neue Deutsche Geschichte der Hebräischen Universität Jerusalem (Professor Moshe Zimmerman), wo er über Antisemitismus in der DDR forschte.
Zusammenfassung
Deutschland spürt das Ende der BehaglichkeitHunderttausende Flüchtlinge suchen Schutz in Europa. Die EU scheint zu zerfallen. Die Ikone Volkswagen wankt. Ein Kalter Krieg gegen Russland ist plötzlich denkbar. Das Unbehagen der Bürger steigt: Woher kommt all das Chaos? Die Flüchtlinge sind die ersten sichtbaren Zeugen für die globale Dimension des Umbruchs. Nach Jahrzehnten des Friedens werden auch wir von den modernen Kriegen eingeholt, die rund um uns toben.Diese modernen Kriege nützen die Möglichkeiten der technologisch-industriellen Revolution und sind daher besonders effizient. Waffen werden nicht mehr von Soldaten bedient, sondern von Computerspezialisten. Söldner kämpfen anstelle regulärer Armeen. Finanzkrieger und Spekulanten machen Jagd auf die Sparguthaben und den Sozialstaat. Die Königsdisziplin ist der Cyber-Krieg: Stromversorgung, Krankenhäuser, Telefonnetze sind anfällig für Attacken. In den Medien toben Propaganda-Schlachten. Das Merkmal der modernen Kriege: Wir wissen nicht mehr, wer ist Feind, wer Freund.Deutschland und Europa sind nicht gewappnet. Die Eliten haben sich in den vergangenen Jahren hauptsächlich um die Absicherung ihres persönlichen Status Quo gekümmert. Diese Haltung kann uns zum Verhängnis werden denn die technologisch-industrielle Revolution hat nicht vor, an unseren Grenzen Halt zu machen. Deutschland ist gezwungen, sich selbst neu zu erfinden. Jetzt geht es darum, die Veränderung zu gestalten oder von ihr überrollt zu werden.
Leseprobe
Einleitung
Als ich im Jahr 1996 von Wien nach Berlin geholt wurde, um aus dem ehemaligen SED-Bezirksblatt "Berliner Zeitung" eine ordentliche Zeitung zu machen, war Deutschland für viele europäische Einwanderer die ideale Mischung von Behaglichkeit und Aufbruch. Man konnte viel erleben, ohne etwas zu riskieren. Die Wiedervereinigung war zwar ein radikaler Bruch, traf aber in erster Linie die Ostdeutschen. Den westdeutschen Eliten bot sich die einmalige Chance einer Zeitreise in die Vergangenheit. So verließen junge, neugierige und außerordentlich belesene Journalisten die behaglichen Redaktionsräume der FAZ, um für ein ehemaliges SED-Propagandablatt die Überreste der DDR zu bestaunen. Sie notierten die Aussagen von müden Helden und eloquenten Verrätern, porträtierten die Zeitzeugen und spotteten über die Spießigkeit der Diktatoren von Wandlitz. In meist brillanten Texten gelang es ihnen, von Goethe bis zur Love Parade immer die richtige historische Reminiszenz zu finden.
Überlegungen, welche Folgen die friedliche Revolution von 1989 für das Deutschland der Zukunft haben würde, standen für die meisten nicht im Vordergrund. Die DDR-Bürgerrechtler spielten keine Rolle. Bärbel Bohley, eine Art Jeanne d'Arc des Mauerfalls, lebte immer noch in ihrer verfallenen Wohnung am Prenzlauer Berg. Später ging sie nach Bosnien, um dem Land beim Wiederaufbau nach dem Krieg zu helfen. Die politischen Macher setzten auf einen wilden Bauboom. Der Alexanderplatz, wo die Redaktion liegt, sollte eine Skyline aus Wolkenkratzern erhalten, vor der selbst New York erblassen würde. Zwanzig Jahre später sieht der Platz immer noch aus wie zu Mielkes Zeiten. Nur die Ost-Kneipe "Das Setz-Ei" hat Pleite gemacht und ist verschwunden. Der DDR-Vorzeigebau, der "Palast der Republik", wurde abgerissen. An dem Ort wird das kaiserliche Stadtschloss rekonstruiert.
Warum hat "die Wende" eigentlich keinen Modernisierungsschub in Deutschland ausgelöst? Die deutschen Eliten haben damals vor allem leidenschaftlich darüber gestritten, welche Folgen die Wiedervereinigung für die Vergangenheit Deutschlands haben würde. Die Zukunft sollte aus der Vergangenheit definiert werden. Ich erinnere mich an nächtelange hitzige Diskussionen mit dem Direktor des Deutschen Historischen Museums in Berlin: Es ging um die Frage, ob die Quadriga vom Brandenburger Tor aus heraldischer Sicht als neues Symbol für die "Berliner Zeitung" taugen könnte, oder das als eine Reminiszenz an Preußen missverstanden werden würde. Wir verwarfen die Idee und entschieden uns für die Modernisierung der Zeitung.
Ich gewann damals den Eindruck, dass die deutschen Eliten eine gewisse Aversion gegen wirklich radikale Veränderungen haben. Unberechenbare Erneuerer werden misstrauisch beäugt. Man fürchtet den radikalen Bruch. Deutschland setzt auf die Perfektion des Bestehenden. Bei neuen Dingen will man erst mal abwarten, ob sie sich bewähren. Wenn allerdings einmal eine Neuerung vollzogen wurde, dann können sich die Deutschen wie kein anderes Volk der Welt an der "inkrementellen Verbesserung" erfreuen: Hier noch ein Schräubchen, da ein Rädchen, dort eine Stellschraube - so wird man Export-Weltmeister.
Doch schon um das Jahr 2000 zeigte sich auch in Deutschland, dass die nächste Umwälzung nicht so einfach zu absorbieren sein würde: Die Internet-Revolution machte die Wiedervereinigung über Nacht zu einer welthistorischen Petitesse. In Amerika legte der russische Einwanderer Sergey Mikhaylovich Brin den Grundstein zu einem neuen Imperium. Google sollte nur wenige Jahre später zu einer Macht werden, die im Zusammenspiel mit anderen Technologie-Gigant…
Titel
Das Ende der Behaglichkeit
Untertitel
Wie die modernen Kriege Deutschland und Europa verndern
Autor
EAN
9783862487929
ISBN
978-3-86248-792-9
Format
E-Book (epub)
Hersteller
Herausgeber
Veröffentlichung
28.11.2015
Digitaler Kopierschutz
frei
Dateigrösse
0.85 MB
Anzahl Seiten
288
Jahr
2015
Untertitel
Deutsch
Lesemotiv
Laden...
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.