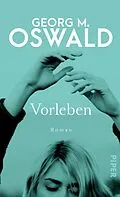Georg M. Oswald, geboren 1963, arbeitet wieder als Jurist in München, nachdem er mehrere Jahre als Verlagsleiter des Berlin Verlags tätig was. Seine Romane und Erzählungen zeigen ihn als gesellschaftskritischen Schriftsteller, sein erfolgreichster Roman 'Alles was zählt' ist mit dem International Prize ausgezeichnet und in zehn Sprachen übersetzt worden. Zuletzt erschienen von ihm die Romane 'Unter Feinden', für dessen psychologischen Realismus und meisterlichen Spannungsaufbau er höchstes Lob erntete, und 'Alle, die du liebst', sowie 'Unsere Grundrechte'.
Von der verführerischen Macht des Zweifelns
Für Sophia, journalistischer Nachwuchsstar auf dem absteigenden Ast, eröffnet sich die große Chance: Sie soll für das Staatliche Symphonieorchester München das Programmheft konzipieren und die Musiker bei ihren Proben und Konzertreisen begleiten. Als aus der Affäre mit dem gefeierten Cellisten Daniel eine Liebesbeziehung wird und sie in seine Wohnung im Glockenbachviertel zieht, braucht sie ein neues Projekt. Sie beginnt, einen Roman zu schreiben, und stößt auf beunruhigende Informationen aus Daniels Vergangenheit. Wenn sie ihrem Verdacht folgt, gefährdet sie ihre Beziehung. Wie wahrhaftig muss Liebe sein?
»Georg M. Oswald ist eine Ausnahmeerscheinung in der gegenwärtigen deutschen Literaturlandschaft.« DIE ZEIT
Autorentext
Georg M. Oswald, geboren 1963, arbeitet wieder als Jurist in München, nachdem er mehrere Jahre als Verlagsleiter des Berlin Verlags tätig was. Seine Romane und Erzählungen zeigen ihn als gesellschaftskritischen Schriftsteller, sein erfolgreichster Roman "Alles was zählt" ist mit dem International Prize ausgezeichnet und in zehn Sprachen übersetzt worden. Zuletzt erschienen von ihm die Romane "Unter Feinden", für dessen psychologischen Realismus und meisterlichen Spannungsaufbau er höchstes Lob erntete, und "Alle, die du liebst", sowie "Unsere Grundrechte".
Zusammenfassung
Von der verführerischen Macht des ZweifelnsFür Sophia, journalistischer Nachwuchsstar auf dem absteigenden Ast, eröffnet sich die große Chance: Sie soll für das Staatliche Symphonieorchester München das Programmheft konzipieren und die Musiker bei ihren Proben und Konzertreisen begleiten. Als aus der Affäre mit dem gefeierten Cellisten Daniel eine Liebesbeziehung wird und sie in seine Wohnung im Glockenbachviertel zieht, braucht sie ein neues Projekt. Sie beginnt, einen Roman zu schreiben, und stößt auf beunruhigende Informationen aus Daniels Vergangenheit. Wenn sie ihrem Verdacht folgt, gefährdet sie ihre Beziehung. Wie wahrhaftig muss Liebe sein?»Georg M. Oswald ist eine Ausnahmeerscheinung in der gegenwärtigen deutschen Literaturlandschaft.« DIE ZEIT
Leseprobe
1.
Warum schöpft man Verdacht gegen jemanden, den man liebt? Und ab wann? Und wenn man es tut, warum folgt man diesem Verdacht? Fragen wie diese stellten sich Sophia Winter seit einigen Tagen. Seit der Mann, den sie in Gedanken ihren Mann nannte, verreist war. Sie nannte ihn so, obwohl sie nicht verheiratet waren und obwohl sie nicht wusste, ob sie es jemals sein würden. Es war nicht ausgeschlossen, dass es einmal so käme, aber sie hatten noch nicht darüber gesprochen.
»Das liegt doch in der Luft«, hatte ihre Freundin Lea neulich am Telefon gesagt. Sophia hatte es abgestritten und sich über die blöde Redewendung geärgert - was lag schon in der Luft? Stickoxide vielleicht, Feinstaub, aber keine Hochzeiten -, doch insgeheim fragte sie sich auch, ob dies nicht der nächste Schritt wäre. Der nächste logische Schritt. So als hätte das, was zwischen Daniel und ihr geschah, je irgendetwas mit Logik zu tun gehabt.
Seit einem halben Jahr kannten sie sich, vor einem halben Jahr hatten sie sich ineinander verliebt, vor einem halben Jahr war sie bei ihm eingezogen. Hals über Kopf, auch so eine Redewendung, die immer wieder gebraucht wurde. Nicht von ihnen, von anderen.
Für sie fühlte es sich nicht so an, das stellten sie gelegentlich lachend fest, wie besonders wagemutige Komplizen, die sich von den Bedenken anderer anfeuern, aber nicht einschüchtern lassen. Alles war schnell gegangen, und wenn etwas, egal was, schnell geht, gibt es immer jemanden, der sagt, das sei zu schnell. Aber wer bestimmt, wie lange es mindestens dauern muss, um sich ineinander zu verlieben und zusammenzuziehen?
Jedes Paar erzählt die Geschichte, wie es sich kennengelernt hat, immer wieder gerne. Staaten haben Gründungsmythen, Paare auch. Wenn sich die Erzählenden ins Gehege kommen, ist das meist kein gutes Zeichen. Sophia und Daniel waren sich über ihre Geschichte einig, sogar über den ersten Satz, den Sophia gerne zu allen möglichen Gelegenheiten zitierte, im Bett, beim Essen, wenn sie mit Freunden zusammensaßen.
»Sie wissen also überhaupt nicht, wer ich bin?«, lautete er. Daniel hatte ihn gesagt, als Sophia sich zu ihm an den Tisch in der Musikerkantine des Herkulessaals setzte. Es war ein Vorstellungsgespräch gewesen. Es gefiel ihr, diesen Satz und ihre Antwort darauf wieder und wieder zu zitieren, wobei sie übertrieben die Stimmen nachahmte.
»Sie wissen also überhaupt nicht, wer ich bin?«, dunkel und bedeutungsschwer, und darauf kieksend sie:
»Ich habe nicht die geringste Ahnung.«
In Wirklichkeit war die Szene nicht so albern gewesen. Er hatte seinen Satz gesagt und dabei gelächelt, als bereite ihm die Vorstellung besonderes Vergnügen. Sie reagierte mit, wie sie hoffte, genug Ironie, um ihm zu signalisieren, dass sie die Regeln des Spiels, das sie gerade begonnen hatten, durchschaute und deshalb nicht zu ernst nahm. Das Spiel hieß: berühmter Cellist trifft Journalistin zum Interview.
Wenn sie jetzt daran dachte, war ihr weniger fröhlich zumute. Vielleicht stimmte es, dass sie überhaupt nicht wusste, wer er war, und zwar in einem Sinn, der weder ihm noch ihr gefallen konnte. Sie war sich dessen nicht sicher. Immer, wenn sie allein in der Wohnung war, verfiel sie ins Grübeln und fing an, alles infrage zu stellen. Die Dinge, die sie umgaben, wurden ihr fremd. Nur mit Daniel zusammen fühlte sie sich eingeladen, alles, was ihm gehörte, auch als ihres zu betrachten.
»Du bist hier zu Hause«, hatte er, vor allem in den ersten Wochen, wieder und wieder zu ihr gesagt, bis sie anfing, es zu glauben. Doch sobald sie alleine war, verflog dieser Glaube, und sie blickte anders auf die Sache. Dann dachte sie: Ich befinde mich in der Wohnung eines fremden Mannes.
Eines Mannes, den sie liebte, und - sie hatte jeden Grund, ihm das zu glauben - der sie liebte, und dennoch, eines Mannes, der die ersten knapp fünfzig Jahre seines Lebens ohne sie ve