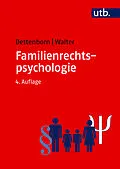Das Standardlehrbuch zur Familienrechtspsychologie vollständig überarbeitet und erweitert. Wenn familiäre Konflikte vor Gericht gelöst werden müssen, ist psychologische Kompetenz für alle beteiligten Berufsgruppen unverzichtbar. Das vorliegende Buch macht den Leser vertraut mit den rechtlichen Grundlagen und der psychologischen Tragweite einzelner Konfliktthemen wie Sorgerecht, Umgangsrecht, Adoption oder Herausnahme von Kindern aus der Familie. Es zeigt anschaulich, wie diese theoretischen Grundkenntnisse in die Praxis der Jugendhilfe, Verfahrenspflege, Beratung und Gutachtertätigkeit eingebracht werden können.
Autorentext
Diplom-Psychologe Dr. Eginhard Walter ist Gutachter im Familienrecht in Berlin.
Inhalt
Abkürzungen 14 Vorwort 15 1 Familienrechtspsychologie als Spezialfach 16 1.1 Gegenstand der Familienrechtspsychologie 16 1.2 Die fachlichen Grundlagen der Familienrechtspsychologie 17 1.2.1 Rechtspsychologie 17 1.2.1.1 Gegenstand und Arbeitsgebiete 17 1.2.1.2 Psychologie und Recht: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 19 1.2.2 Familienpsychologie 21 1.2.3 Familienrecht, Kinder- und Jugendhilferecht, Kindschaftsrecht 22 1.2.4 Integration Bausteine einer familienrechtspsychologischen Systematik 26 1.2.5 Tendenzen 27 1.3 Das Spannungsfeld von Diagnostik und Intervention 29 2 Psychologische Beurteilung familienrechtlicher Probleme Theoriebausteine 32 2.1 Zur Systematik 32 2.2 Konflikt 32 2.3 Beziehungen und Bindungen in familiären Rechtskonflikten 35 2.3.1 Beziehungen 35 2.3.1.1 Was kennzeichnet Beziehungen? 36 2.3.2 Bindungen 36 2.3.2.1 Bindungstheorie und Kindeswohlbezug 36 2.3.2.2 Bindungsmuster 41 2.3.2.3 Entwicklung von Bindungen 43 2.3.2.4 Diagnostik von Bindungen 46 2.3.2.5 Fehlerquellen der Bindungsdiagnostik 49 2.3.2.6 Exkurs: Bindungen und Zeiterleben des Kindes 53 2.4 Stresserleben und Coping bei kritischen Familienereignissen 55 2.4.1 Familiäre Konflikte mit und ohne Stress 55 2.4.2 Risikofaktoren 56 2.4.2.1 Personale Risikofaktoren 57 2.4.2.2 Risikofaktoren in der Umwelt (Stressoren) 58 2.4.3 Schutzfaktoren 59 2.4.4 Das Zusammenwirken von Risiko- und Schutzfaktoren 59 2.4.4.1 Vulnerabilität und Resilienz 59 2.4.5 Bewältigung von Stress 60 2.4.5.1 Copingarten 60 2.4.5.2 Coping im Kindesalter 62 2.4.6 Wahrgenommene Kontrollierbarkeit kritischer Familienereignisse 64 2.4.7 Initiatorstatus und Kontrollüberzeugung 67 2.5 Das Wohl des Kindes 68 2.5.1 Problematik und Funktion des Begriffs 68 2.5.2 Definition 71 2.5.3 Gebrauchskontexte 74 2.5.3.1 Die Bestimmung der Bestvariante 75 2.5.3.2 Die Bestimmung der Genug-Variante 75 2.5.3.3 Gefährdungsabgrenzung 76 2.6 Der Wille des Kindes 79 2.6.1 Rechtliche Grundlagen 79 2.6.1.1 Übergreifende Intentionen 80 2.6.2 Psychologie des Kindeswillens 81 2.6.2.1 Definition 81 2.6.2.2 Stadien der Willensbildung 82 2.6.2.3 Mindestanforderungen 84 2.6.2.4 Kindeswille und Kindesalter 86 2.6.3 Kindeswohl und Kindeswille 93 2.6.4 Selbstgefährdender Kindeswille 95 2.6.5 Induzierter Kindeswille 99 2.6.5.1 Arten der Induzierung 99 2.6.5.2 Effekte der Induzierung 100 2.6.6 Die Diagnostik des Kindeswillens 102 2.6.6.1 Methodische Zugänge 102 2.6.6.1.1 Formale Ebene 102 2.6.6.1.2 Inhaltliche Ebene 103 2.6.6.2 Komplikationen und Gefahren 106 2.6.7 Der Umgang mit dem Kindeswillen 108 2.6.8 Kindeswille und Extremkonflikte 111 2.6.8.1 Parental Alienation Syndrom (PAS) als Streitobjekt 111 2.6.8.1.1 Was ist PAS? 111 2.6.8.1.2 Was bringt PAS? 113 2.6.8.1.3 Die Negierung des Kindeswillens 114 2.6.8.2 Kindeswille und Entfremdungsgeschehen 114 2.6.8.2.1 Beeinflussung, Stress, Entfremdung 114 2.6.8.2.2 Bewältigungsprozesse und Kindeswille 115 2.6.8.2.3 Eigenanteil des Kindes Initiatorstatus 117 2.6.8.2.4 Interventionsrisiko und Entfremdung 118 2.7 Erziehungsfähigkeit 123 2.7.1 Definition 123 2.7.2 Die Fragestellung der Erziehungsfähigkeit im familiengerichtlichen Verfahren 123 2.7.3 Individuelle Bestimmungsgrößen der Erziehungsfähigkeit 124 2.7.3.1 Erziehungsziele 124 2.7.3.2 Erziehungseinstellungen 125 2.7.3.3 Erziehungskenntnisse 127 2.7.3.4 Kompetenzen des Erziehenden 128 2.7.3.5 Erziehungsverhalten 129 3 Konfliktbehandlung im familienrechtlichen Bereich 135 3.1 Die Zugänge zum Konflikt 135 3.2 Der Paradigmenwandel im familienrechtlichen Konfliktmanagement 136 3.2.1 Von der engen Verfahrenssicht zum psychologischen Konfliktmanagement 136 3.3 Mediation als Inflation und richterliche Tätigkeit 138 3.4 Mediation, Beratung und Freiwilligkeit 140 3.4.1 Pflichtberatung ohne Scheinakzeptanz 140 3.5 Kooperation und Kompetition Vorteile und Nachteile 142 3.5.1 Kompetitive Anspruchspositionen 143 3.5.2 Interessenausgleich und Kooperation 144 3.5.3 Autonomie als Vorteil und Bürde 144 3.6 Konfliktentwicklung bei Trennung und Scheidung 145 3.6.1 Konflikteskalation und Hochkonflikt 145 3.6.2 Hochkonflikthaftigkeit als Verhalten 147 3.6.3 Eskalationskriterien bei Hochkonflikthaftigkeit 150 3.6.4 Umgang mit den Eskalationskriterien 152 3.6.5 Hochkonflikt und Intervention 153 3.6.5.1 Spezifische Interventionsbedingungen 153 3.6.5.2 Die Grenzen und Möglichkeiten des Hinwirkens auf Einvernehmen bei Hochkonflikthaftigkeit 155 3.6.5.3 Hochkonflikthaftigkeit und Kindeswohlgefährdung 156 3.6.5.4 Vernetzung und Kontrolle 157 3.6.5.5 Wege und Abwege 158 3.6.5.6 Gebrauch von Machtmitteln 162 3.7 Das Vertrauensdilemma 163 3.8 Einwandbegegnung 166 3.8.1 Funktionen, Formen und Inhalte von Einwänden 166 3.8.2 Grundsätze der Einwandbegegnung 167 3.8.3 Techniken der Einwandbegegnung 168 3.9 Querulanz als spezifische Konfliktquelle 170 3.9.1 Der Querulant als Teilnehmer am Rechtsgeschehen 170 3.9.2 Beurteilung von Querulanz 171 3.9.2.1 Querulanz als Eigenschaft 171 3.9.2.2 Querulanz als fehlgelerntes Verhalten 172 3.9.2.3 Querulieren als motiviertes, zielgerichtetes Handeln 172 3.9.2.4 Querulieren als gestörte Kommunikation 173 3.9.2.5 Querulanz als Zuschreibungseffekt 173 3.9.3 Umgang mit Querulanz 174 3.9.3.1 Selbstmanagement 174 3.9.3.2 Interaktionsmanagement 176 4 Die elterliche Sorge 178 4.1 Rechtliche Grundlagen 178 4.1.1 Elterliche Sorge 178 4.1.2 Elterliche Sorge bei Trennung 179 4.2 Die psychologische Problematik und ihre Beurteilung 184 4.2.1 Die juristischen und psychologischen Fragestellungen 184 4.2.2 Ziele der Sorgerechtsregelung 187 4.2.3 Die Vorteile einer gelungenen Sorgerechtsregelung 187 4.2.4 Die Eigendynamik einer misslungenen Sorgerechtsregelung 191 4.3 Trennungsfolgen 199 4.3.1 Folgen für die Eltern 199 4.3.2 Folgen für das Kind 200 4.3.2.1 Verlauf 200 4.3.2.2 Geschlecht 203 4.3.2.3 Alter und Entwicklungsstand 203 4.3.2.3.1 Erstes Lebensjahr 203 4.3.2.3.2 Zweites und drittes Lebensjahr 205 4.3.2.3.3 Viertes und fünftes Lebensjahr 206 4.3.2.3.4 Sechstes bis neuntes Lebensjahr 207 4.3.2.3.5 Neuntes bis elftes Lebensjahr 208 4.3.2.3.6 Zwölftes Lebensjahr und älter 209 4.4 Beurteilungskriterien zur Regelung der elterlichen Sorge 210 4.4.1 Das Kontinuitätsprinzip 210 4.4.2 Die Beziehungen und Bindungen des Kindes 213 4.4.3 Die Geschwisterbeziehungen 216 4.4.4 Der Wille des Kindes 218 4.4.5 Die Erziehungsfähigkeit 220 4.4.6 Die elterliche Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft 221 4.4.7 Die elterliche Bindungstoleranz 224 4.5 Betreuungsmodelle bei Getrenntleben der Eltern 225 4.5.1 Formen und Häufigkeiten 226 4.5.2 Psychologische Beurteilungskriterien 229 4.5.2.1 Bisherige Betreuungsanteile 229 4.5.2.2 Wechselhäufigkeit 231 4.5.2.3 Konfliktniveau der Eltern 231 4.5.2.4 Rigidität versus Flexibilität der Regelung 232 4.5.2.5 Altersabhängigkeit der Regelung 233 4.5.2.5.1 Erstes bis drittes Lebensjahr 233 4.5.2.5.2 Viertes und fünftes Lebensjahr 235 4.5.2.5.3 Sechstes bis elftes Lebensjahr 235 4.5.2.5.4 Zwölftes Lebensjahr und älter 236 4.5.2.6 Geschwister 236 5 Der Umgang mit dem Kind 238 5.1 Rechtliche Grundlagen 238 5.2 Die psychologische Problematik im Umgangsstreit und ihre Beurteilung 243 5.2.1 Umgang und Umgangsstreit 243 5.2.2 Umgang und Kindeswohl 244 5.2.3 Die juristischen Fragestellungen 245 5.2.4 …
Autorentext
Diplom-Psychologe Dr. Eginhard Walter ist Gutachter im Familienrecht in Berlin.
Inhalt
Abkürzungen 14 Vorwort 15 1 Familienrechtspsychologie als Spezialfach 16 1.1 Gegenstand der Familienrechtspsychologie 16 1.2 Die fachlichen Grundlagen der Familienrechtspsychologie 17 1.2.1 Rechtspsychologie 17 1.2.1.1 Gegenstand und Arbeitsgebiete 17 1.2.1.2 Psychologie und Recht: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 19 1.2.2 Familienpsychologie 21 1.2.3 Familienrecht, Kinder- und Jugendhilferecht, Kindschaftsrecht 22 1.2.4 Integration Bausteine einer familienrechtspsychologischen Systematik 26 1.2.5 Tendenzen 27 1.3 Das Spannungsfeld von Diagnostik und Intervention 29 2 Psychologische Beurteilung familienrechtlicher Probleme Theoriebausteine 32 2.1 Zur Systematik 32 2.2 Konflikt 32 2.3 Beziehungen und Bindungen in familiären Rechtskonflikten 35 2.3.1 Beziehungen 35 2.3.1.1 Was kennzeichnet Beziehungen? 36 2.3.2 Bindungen 36 2.3.2.1 Bindungstheorie und Kindeswohlbezug 36 2.3.2.2 Bindungsmuster 41 2.3.2.3 Entwicklung von Bindungen 43 2.3.2.4 Diagnostik von Bindungen 46 2.3.2.5 Fehlerquellen der Bindungsdiagnostik 49 2.3.2.6 Exkurs: Bindungen und Zeiterleben des Kindes 53 2.4 Stresserleben und Coping bei kritischen Familienereignissen 55 2.4.1 Familiäre Konflikte mit und ohne Stress 55 2.4.2 Risikofaktoren 56 2.4.2.1 Personale Risikofaktoren 57 2.4.2.2 Risikofaktoren in der Umwelt (Stressoren) 58 2.4.3 Schutzfaktoren 59 2.4.4 Das Zusammenwirken von Risiko- und Schutzfaktoren 59 2.4.4.1 Vulnerabilität und Resilienz 59 2.4.5 Bewältigung von Stress 60 2.4.5.1 Copingarten 60 2.4.5.2 Coping im Kindesalter 62 2.4.6 Wahrgenommene Kontrollierbarkeit kritischer Familienereignisse 64 2.4.7 Initiatorstatus und Kontrollüberzeugung 67 2.5 Das Wohl des Kindes 68 2.5.1 Problematik und Funktion des Begriffs 68 2.5.2 Definition 71 2.5.3 Gebrauchskontexte 74 2.5.3.1 Die Bestimmung der Bestvariante 75 2.5.3.2 Die Bestimmung der Genug-Variante 75 2.5.3.3 Gefährdungsabgrenzung 76 2.6 Der Wille des Kindes 79 2.6.1 Rechtliche Grundlagen 79 2.6.1.1 Übergreifende Intentionen 80 2.6.2 Psychologie des Kindeswillens 81 2.6.2.1 Definition 81 2.6.2.2 Stadien der Willensbildung 82 2.6.2.3 Mindestanforderungen 84 2.6.2.4 Kindeswille und Kindesalter 86 2.6.3 Kindeswohl und Kindeswille 93 2.6.4 Selbstgefährdender Kindeswille 95 2.6.5 Induzierter Kindeswille 99 2.6.5.1 Arten der Induzierung 99 2.6.5.2 Effekte der Induzierung 100 2.6.6 Die Diagnostik des Kindeswillens 102 2.6.6.1 Methodische Zugänge 102 2.6.6.1.1 Formale Ebene 102 2.6.6.1.2 Inhaltliche Ebene 103 2.6.6.2 Komplikationen und Gefahren 106 2.6.7 Der Umgang mit dem Kindeswillen 108 2.6.8 Kindeswille und Extremkonflikte 111 2.6.8.1 Parental Alienation Syndrom (PAS) als Streitobjekt 111 2.6.8.1.1 Was ist PAS? 111 2.6.8.1.2 Was bringt PAS? 113 2.6.8.1.3 Die Negierung des Kindeswillens 114 2.6.8.2 Kindeswille und Entfremdungsgeschehen 114 2.6.8.2.1 Beeinflussung, Stress, Entfremdung 114 2.6.8.2.2 Bewältigungsprozesse und Kindeswille 115 2.6.8.2.3 Eigenanteil des Kindes Initiatorstatus 117 2.6.8.2.4 Interventionsrisiko und Entfremdung 118 2.7 Erziehungsfähigkeit 123 2.7.1 Definition 123 2.7.2 Die Fragestellung der Erziehungsfähigkeit im familiengerichtlichen Verfahren 123 2.7.3 Individuelle Bestimmungsgrößen der Erziehungsfähigkeit 124 2.7.3.1 Erziehungsziele 124 2.7.3.2 Erziehungseinstellungen 125 2.7.3.3 Erziehungskenntnisse 127 2.7.3.4 Kompetenzen des Erziehenden 128 2.7.3.5 Erziehungsverhalten 129 3 Konfliktbehandlung im familienrechtlichen Bereich 135 3.1 Die Zugänge zum Konflikt 135 3.2 Der Paradigmenwandel im familienrechtlichen Konfliktmanagement 136 3.2.1 Von der engen Verfahrenssicht zum psychologischen Konfliktmanagement 136 3.3 Mediation als Inflation und richterliche Tätigkeit 138 3.4 Mediation, Beratung und Freiwilligkeit 140 3.4.1 Pflichtberatung ohne Scheinakzeptanz 140 3.5 Kooperation und Kompetition Vorteile und Nachteile 142 3.5.1 Kompetitive Anspruchspositionen 143 3.5.2 Interessenausgleich und Kooperation 144 3.5.3 Autonomie als Vorteil und Bürde 144 3.6 Konfliktentwicklung bei Trennung und Scheidung 145 3.6.1 Konflikteskalation und Hochkonflikt 145 3.6.2 Hochkonflikthaftigkeit als Verhalten 147 3.6.3 Eskalationskriterien bei Hochkonflikthaftigkeit 150 3.6.4 Umgang mit den Eskalationskriterien 152 3.6.5 Hochkonflikt und Intervention 153 3.6.5.1 Spezifische Interventionsbedingungen 153 3.6.5.2 Die Grenzen und Möglichkeiten des Hinwirkens auf Einvernehmen bei Hochkonflikthaftigkeit 155 3.6.5.3 Hochkonflikthaftigkeit und Kindeswohlgefährdung 156 3.6.5.4 Vernetzung und Kontrolle 157 3.6.5.5 Wege und Abwege 158 3.6.5.6 Gebrauch von Machtmitteln 162 3.7 Das Vertrauensdilemma 163 3.8 Einwandbegegnung 166 3.8.1 Funktionen, Formen und Inhalte von Einwänden 166 3.8.2 Grundsätze der Einwandbegegnung 167 3.8.3 Techniken der Einwandbegegnung 168 3.9 Querulanz als spezifische Konfliktquelle 170 3.9.1 Der Querulant als Teilnehmer am Rechtsgeschehen 170 3.9.2 Beurteilung von Querulanz 171 3.9.2.1 Querulanz als Eigenschaft 171 3.9.2.2 Querulanz als fehlgelerntes Verhalten 172 3.9.2.3 Querulieren als motiviertes, zielgerichtetes Handeln 172 3.9.2.4 Querulieren als gestörte Kommunikation 173 3.9.2.5 Querulanz als Zuschreibungseffekt 173 3.9.3 Umgang mit Querulanz 174 3.9.3.1 Selbstmanagement 174 3.9.3.2 Interaktionsmanagement 176 4 Die elterliche Sorge 178 4.1 Rechtliche Grundlagen 178 4.1.1 Elterliche Sorge 178 4.1.2 Elterliche Sorge bei Trennung 179 4.2 Die psychologische Problematik und ihre Beurteilung 184 4.2.1 Die juristischen und psychologischen Fragestellungen 184 4.2.2 Ziele der Sorgerechtsregelung 187 4.2.3 Die Vorteile einer gelungenen Sorgerechtsregelung 187 4.2.4 Die Eigendynamik einer misslungenen Sorgerechtsregelung 191 4.3 Trennungsfolgen 199 4.3.1 Folgen für die Eltern 199 4.3.2 Folgen für das Kind 200 4.3.2.1 Verlauf 200 4.3.2.2 Geschlecht 203 4.3.2.3 Alter und Entwicklungsstand 203 4.3.2.3.1 Erstes Lebensjahr 203 4.3.2.3.2 Zweites und drittes Lebensjahr 205 4.3.2.3.3 Viertes und fünftes Lebensjahr 206 4.3.2.3.4 Sechstes bis neuntes Lebensjahr 207 4.3.2.3.5 Neuntes bis elftes Lebensjahr 208 4.3.2.3.6 Zwölftes Lebensjahr und älter 209 4.4 Beurteilungskriterien zur Regelung der elterlichen Sorge 210 4.4.1 Das Kontinuitätsprinzip 210 4.4.2 Die Beziehungen und Bindungen des Kindes 213 4.4.3 Die Geschwisterbeziehungen 216 4.4.4 Der Wille des Kindes 218 4.4.5 Die Erziehungsfähigkeit 220 4.4.6 Die elterliche Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft 221 4.4.7 Die elterliche Bindungstoleranz 224 4.5 Betreuungsmodelle bei Getrenntleben der Eltern 225 4.5.1 Formen und Häufigkeiten 226 4.5.2 Psychologische Beurteilungskriterien 229 4.5.2.1 Bisherige Betreuungsanteile 229 4.5.2.2 Wechselhäufigkeit 231 4.5.2.3 Konfliktniveau der Eltern 231 4.5.2.4 Rigidität versus Flexibilität der Regelung 232 4.5.2.5 Altersabhängigkeit der Regelung 233 4.5.2.5.1 Erstes bis drittes Lebensjahr 233 4.5.2.5.2 Viertes und fünftes Lebensjahr 235 4.5.2.5.3 Sechstes bis elftes Lebensjahr 235 4.5.2.5.4 Zwölftes Lebensjahr und älter 236 4.5.2.6 Geschwister 236 5 Der Umgang mit dem Kind 238 5.1 Rechtliche Grundlagen 238 5.2 Die psychologische Problematik im Umgangsstreit und ihre Beurteilung 243 5.2.1 Umgang und Umgangsstreit 243 5.2.2 Umgang und Kindeswohl 244 5.2.3 Die juristischen Fragestellungen 245 5.2.4 …
Titel
Familienrechtspsychologie
EAN
9783838588117
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
17.10.2022
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
515
Auflage
4. vollst. überarb. u. erw. Aufl.
Lesemotiv
Laden...
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.