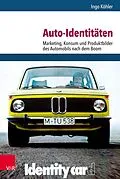The book deals with the material culture of individual mass motorization in Germany since the 1960s. It asks how German and North-American car companies differed in their responses to the challenges of economic and social change, emerging public consumerism, and eco-criticism. The study not only kept an eye on the practical implementation of interactive marketing management, and showed that the >management of change< of the firms benefit greatly from enormous scientific advances in market research techniques. Moreover, the study traced the transfer of marketing ideas and know-how between the United States and Germany. Unveiling the great difficulties of US-consultants as well as the Ford and GM branches in Germany when adapting their proven-in-use marketing methods to different social stratifications and market conditions, the book shed new light on the still popular notion of >Americanization<. Here, comparing the marketing strategies of domestic and foreign automobile manufactures provided a relational microanalysis of the impacts of globalisation on a local market level.
Autorentext
PD Dr. Ingo Köhler ist Wirtschaftshistoriker an der Georg-August-Universität Göttingen. Momentan beschäftigt er sich im Rahmen des DFG Schwerpunktprogramms 1859 »Erfahrungen und Erwartungen. Historische Grundlagen ökonomischen Handelns« mit der Geschichte der Marktforschung in Deutschland und den USA.
Klappentext
Die Studie spiegelt die soziokulturellen Transformationsprozesse »nach dem Boom« in einer Produkt- und Marketinggeschichte des Automobils. Minutiös werden Brüche und Kontinuitäten in der Genese der materiellen Kultur des Leitprodukts der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft beschrieben. Eindrucksvoll belegt der Autor, dass sich die Pluralisierung des Konsums erst im Zuge der Krisen der 1970er Jahre dynamisierte. Gleichwohl waren es weniger die Konsumenten, die sich für die Umweltfolgen der massenhaften Autonutzung sensibilisierten. Stattdessen kündigten die medialen politischen und publizistischen Eliten den Autokonsens der Wiederaufbaujahre auf. Im spannungsgeladenen Konfliktfeld zwischen individuellen und kollektiven Interessen hatten sich die Unternehmen mit neuen Anspruchsgruppen und Konsumbedürfnissen auseinanderzusetzen. Die Arbeit nimmt diese Diskurse in den Blick und liefert eine transnationale Wissensgeschichte des
Managements of Change.
In einem Vergleich deutscher und deutsch-amerikanischer Konzerne beschreibt sie, wie kundenorientierte Modelle des Marketingmanagements lang etablierte technische Produktionsparadigmen verdrängten. Marktforschung und Gesellschaftsmonitoring zählten nun zu unverzichtbaren Werkzeugen für die Branche, um in einem zunehmend unsicheren Umfeld zu agieren. Die Kreation eines markentypischen Images avancierte zum Ansatzpunkt einer neuartigen Steuerung der Unternehmen vom Konsumenten aus. Die Umbrüche der 1970er Jahre führten somit nicht nur zu einer Neuvermessung der Rolle des Automobils in der Gesellschaft, sondern auch zu einem nachhaltigen Wandel der unternehmerischen Organisation, Kommunikation und Strategiebildung. In der historischen Analyse des Image-Marketings lassen sich Werkzeuge entdecken, um auch die gegenwärtigen Herausforderungen einer erneut veränderten Wahrnehmung des Automobils zu bewältigen.