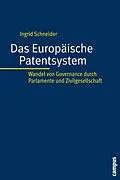Das Patentrecht, lange alleinige Domäne von Juristen und Technikern, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend internationalisiert und politisiert. Insbesondere um die Biotechnologie- Patentrichtlinie der EU wurde eine kontroverse Debatte geführt. Ingrid Schneider belegt, wie dieser Politikprozess die Governance des europäischen Patentsystems verändert hat. Parlamente und zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit haben neue sozioökonomische, ethische und kulturelle Sichtweisen eingebracht, die eine angemessene Balance zwischen Patentschutz und anderen gesellschaftlichen Normen halten sollen und zur Demokratisierung des Patentsystems beigetragen haben.
Autorentext
Ingrid Schneider, Dr. phil., ist Privatdozentin für Politikwissenschaft am Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Hamburg.
Inhalt
Inhalt
Dank
Einleitung
Teil I: Theorie und Grundlagen
AGovernancetheorie und die Unverzichtbarkeit von Parlamenten
1.Begriffsdefinitionen: Governance als erweiterte Steuerungsperspektive (Mayntz)
2.Würdigung des Governance-Konzepts und eigene Schwerpunktsetzung
3."Bringing parliaments back in": Die Unverzichtbarkeit von Parlamenten und formaler Gesetzgebung
4.Das Europäische Parlament
5.Das Schleusenmodell von Peters/Habermas als demokratietheoretischer Ansatz
6.Kontroversen als Ressource für Governance
7.Argumentieren und Verhandeln
8.Fazit
BPolicy-Analyse, Diskursanalyse und Frame-Analyse
1.Zur Policy-Analyse in der Politikwissenschaft
2."Linguistic Turn" und "Argumentative Turn" in der Policy-Analyse
3.Diskursanalyse als Policy-Analyse
4.Frame-Theorie und Methodik als Ausformung der Diskursanalyse
4.1Frame-Theorie: disziplinäre und epistemologische Wurzeln
4.2Frames: Definition des Konzepts
4.3Merkmale und Funktionsweisen von Frames
4.4Frames und die Konzeptualisierung von Akteuren und Strukturen
4.5Ermöglichende und restringierende Funktionen von Frames: Diskurskoalitionen und Ausschlüsse
4.6Frame-Ebenen und Typologien
4.7Frame-Konstellationen: Simultane und antagonistische Frames
4.8Frame-Dynamiken und Reframing
5.Zur Methode der Frame-analytischen Policy-Analyse
6.Relevanz der Frame-Theorie für die Politikwissenschaft und Anschlussfähigkeit an andere politikwissenschaftliche Ansätze
7.Zusammenfassung
CPatentrecht: Geschichte, Grundlagen und Theorien
1.Zur Geschichte des Patentrechts
2.Das Europäische Patentrecht nach dem Europäischen Patentübereinkommen
3.Legitimations- und Wirkungstheorien des Patentrechts
4.Die klassischen juristischen Patentrechtstheorien
5.Ökonomische Patentrechtstheorien und empirische Forschungen
5.1Der public good-Charakter von Wissen und Erfindungen (Arrow, Nelson)
5.2Der empirisch gestützte ökonomische Skeptizismus gegenüber dem Patentschutz
6.Neue Funktionen des Patentschutzes: Zur produktiven und strategischen oder destruktiven Nutzung von Patenten
7.Die Janusköpfigkeit des Patentschutzes: Spannungsverhältnisse und Zielkonflikte
7.1Erfindungs- oder Investitionsschutz? Patente als Versicherung, Lotterie oder Beglaubigungsgut
7.2Technologietransfer: Kommerzialisierung der Wissenschaft oder Privatisierung der Grundlagenforschung?
7.3Individuelle Erfindung oder kollektive Innovation?
7.4Kumulative und sequentielle Innovation
7.5Return oder Kredit auf die Investition: Ist früher und breiter Patentschutz die Lösung oder ein Problem?
7.6Zusammenfassung: Die Janusköpfigkeit des Patentschutzes
8.Die notwendige Neubegründung des Sozialvertrags im Patentrecht
DDie Architektur des europäischen Patentsystems
1.Die Europäische Patentorganisation (EPO)
1.1Zweck und Zielsetzung, rechtliche Grundlagen
1.2Die Entwicklung der EPO- Vertragsstaaten und der EU-Mitgliedschaften
1.3Die Governance-Struktur der EPO: Verwaltungsrat, Europäisches Patentamt und Beschwerdekammern
1.4Das Europäische Patentamt - Wachstumsdynamik eines Amtes
1.5Rechtlich-institutionelle Hürden für eine Revision des EPÜ und für Änderungen in der EPO- Governance
1.6Die Supranationalität der Europäischen Patentorganisation und des Europäischen Patentamtes
1.7Demokratiedefizite und Fehlentwicklungen in der EPO
2.Die Patentpolitik der Europäischen Union
3.Das Verhältnis zwischen EPO und EU
4.Zusammenfassung
EDie epistemische Gemeinschaft des Patentrechts
1.Patentrecht als konstitutiv juridifiziertes soziales Verhältnis und die disziplinäre Subsumtion unter das Privatrecht
2.Das theoretische Konzept der "epistemischen Gemeinschaft"
3.Die epistemische Gemeinschaft des Patentrechts
3.1Geteilte normative und kognitive Prinzipien: Die Glaubenssätze des Patentrechts
3.2Geteilte Kausalvorstellungen, Wissensbasis und Policy-Enterprise
4.Besonderheiten rechtlicher epistemischer Gemeinschaften und patentrechtsspezifische Governance-Muster
5.Exkurs zur Rolle der Patentanmelderschaft
6.Zur Bedeutung und Funktion von epistemischen Gemeinschaften
7.Bedeutung der epistemischen Gemeinschaft für die Ausrichtung der Governance des Patentrechts
8.Zusammenfassung
FDie Vorgeschichte der Biotechnologie-Patent-Governance in Europa: Grenzziehungen im Patentrecht und ihre Erosion durch Ämter und Gerichte
1.Grenzen der Patentierbarkeit im EPÜ
2.Die Grenze zwischen Entdeckung und Erfindung
3.Schutz von Stoffen versus Verfahrensschutz
4.Belebte versus unbelebte Natur und Naturstoffe
5.Der Umfang des Stoffschutzes: zweckgebunden oder absolut?
6.Die Herkunft als Unterscheidungskriterium? Menschliche und nicht-menschliche Stoffe
7.Chirurgische und therapeutische Verfahren am Menschen (Heilverfahren)
8.Der Ordre Public als Grenze
9.Zwischenergebnis: Erodierte Grenzen
10.Implikationen und paradoxe Effekte der angewandten Patentdogmatik: der Verlust von "inneren" Grenzen
11.Normative und konsequentialistisch abgeleitete Funktionen von Grenzziehungen
11.1Der Patentausschluss für Entdeckungen
11.2Der Stand der Technik und der "Durchschnittsfachmann" als Regulativ
11.3Der Ordre Public Vorbehalt
12.Demokratietheoretische Problematisierung: Law making und Agency durch die Judikative: Gerichte als "Ersatzgesetzgeber"
13.Zusammenfassung
Teil II: Empirie
APolicy-Analyse der EU-Biopatentrichtlinie
1.Die erste Phase des Gesetzgebungsprozesses (1988-1995)
1.1Die Vorgeschichte der Richtlinie: Schritte zum Agenda-Setting
1.2Der erste Richtlinienvorschlag der Kommission vom 21.10.1988
1.3Die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 26.4.1989
1.4Der Mensch als Gegenstand des Patentrechts - kleiner juristischer Exkurs
1.5Die Stellungnahme des Parlaments zum Richtlinienvorschlag vom 29.10.1992
1.6Die parlamentarische Debatte
1.7Kritische Würdigung
1.8Der geänderte Richtlinienvorschlag der Kommission vom 16.12.1992
1.9Die Stellungnahme der Beratergruppe "Ethik der Biotechnologie" (GAEIB) vom 30.9.1993
1.10Der Gemeinsame Standpunkt des Rates vom 7.2.1994 als Resultat von Verfahrens-Änderungen nach dem Vertrag von Maastricht
1.11Eine abgebrochene Abstimmung: Abänderungsanträge des Europäischen Parlaments zur zweiten Lesung im Plenum am 5.5.1994
1.12Die Stellungnahmen der Kommission und des Rats zu den Abänderungen des Parlaments am 9.6.1994
1.13Das Vermittlungsverfahren zwischen dem Parlament und dem Rat
1.14Das Scheitern des Richtlinien-Vorschlages durch die Ablehnung des Parlaments am 1.3.1995
1.15Analyse des Scheiterns der Biopatentrichtlinie im Jahr 1995
1.15.1Inhaltlich-substantielle Fragen
1.15.2Diskontinuitäten durch den Wechsel der Legislaturperiode
1.15.3Entscheidungsregeln und Verfahrensfragen
2.Die "zweite Runde" des Gesetzgebungsverfahrens (1995-1998)
2.1Der neue Richtlinien-Vorschlag der Kommission vom 13.12.1995
2.1.1Die Begründung des neuen Richtlinien- Vorschlag…