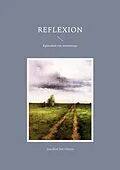Joachim Jan Glatza beschreibt in Episoden und sehr persönlich bedrückende und fröhliche Ereignisse seines Lebens. 1945, mit Kriegsende in der Prignitz geboren, war ein dörfliches Milieu sein zu Hause, mit seiner Mutter, den Großeltern und ohne Vater, ein Nachkriegskind. In der Kleinstadt Pritzwalk lernte er Handelskaufmann, studierte in Potsdam Pädagogik, arbeitete im Kinderheim und der Wohlfahrtspflege. Er war verheiratet und hat zwei Kinder. Mit seinem Partner zog er nach Spanien. Nach einigen Jahren kehrten sie zurück. Gesundheitliche Probleme wurden lebensbestimmend. Er bewältigt diese mit einer optimistischen Lebenseinstellung.
Autorentext
Joachim Jan Glatza beschreibt in Episoden und sehr persönlich bedrückende und fröhliche Ereignisse seines Lebens.
1945, mit Kriegsende in der Prignitz geboren, war ein dörfliches Milieu sein zu Hause, mit seiner Mutter, den Großeltern und ohne Vater, ein Nachkriegskind.
In der Kleinstadt Pritzwalk lernte er Handelskaufmann, studierte in Potsdam Pädagogik, arbeitete im Kinderheim und der Wohlfahrtspflege.
Er war verheiratet und hat zwei Kinder.
Mit seinem Partner zog er nach Spanien.
Nach einigen Jahren kehrten sie zurück.
Gesundheitliche Probleme wurden lebensbestimmend.
Er bewältigt diese mit einer optimistischen Lebenseinstellung.
Leseprobe
Schönhagen
1945-1953
Mit Beendigung des Krieges bin ich in ein Prignitzer Landleben mit Abenteuern und Bauernhof hineingeboren worden.
Schönhagen, ein damals rückständiges Dorf in der Prignitz, nicht weit von der Kreisstadt Pritzwalk, war mein erstes Zuhause.
Meine Familie waren Mutter, Großmutter Katharina und Großvater Gustav, die eigentlich meine Urgroßeltern waren. Das verstand ich damals nicht. Ein Vater war nicht da für mich. Ich bin wohl damit klar gekommen, was sollte ich auch anderes tun. Außerdem wusste ich ja nicht, wie es anders gewesen sein könnte. Vielleicht hatte man deshalb als Kind sowohl Spaß und Freude als auch traurige Momente einfach so hingenommen. Es hieß, alles wird wieder gut! Das wurde mehr als nur eine Redewendung für mich, eine Lebensphilosophie, an die ich mich später und bis heute erinnere.
Da waren um mich herum noch Hund und Katz, Kuh und Schwein, auch Federvieh wie Hühner, Gänse, Enten, Ratten und Mäuse. In der Nachbarschaft wieherten Pferde, blökten Schafe und meckerten Ziegen, es gab immer irgendwelche tierischen Laute, die gehörten einfach dazu. Fast alle Schimpfwörter liefen hier als Tiere herum. Dazu kamen die Geräusche der wenigen Leute, die ringsum wohnten. Manche lebten in ebensolchen kleinen Hütten wie wir. Oft waren es Fachwerkhäuser, die auf einem Sockel von Feldsteinen errichtet worden waren. Die Männer konnten eigentlich alle, wenn sie sich ausstreckten, in die Dachrinne greifen, so niedrig war unsere Behausung. Dieser Ort wurde früher auch gerne für die vorübergehende Aufbewahrung eines Schlüssels genutzt.
Das Dorf Schönhagen hatte seinen Namen aus der historischen Absicht, was man daraus machen wollte.
Heute ist es tatsächlich ein schöner Ort.
Hier fing für mich alles an, mit täglich einem Löffel voll Lebertran, der meine Knochen stabiler werden ließ.
Wer das durchsteht, geht schon gestärkt durchs Leben!
Kirche, Schmiede, Pferdefuß
Weiter entfernt, die Dorfstraße entlang und drumherum, gab es aber größere Häuser, mit Vorgarten und sogar Stufen. Wir wohnten in der Nähe des alten Gutshauses, mit Hof, Ställen mit Pferden, Kühen und Schweinen. In der Mitte des Hofes der immer dampfende Misthaufen.
Großvater Gustav betreute insbesondere den Pferdestall.
Er wurde als bester Pferdeflüsterer geschätzt.
Man sah ihm seine Passion an, wenn er mal stolz umher ritt. Schönhagen schien mir, wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, damals noch sehr verschlafen und rückständig zu sein. Das hatte aber einen besonderen Reiz für mich.
Über die oft staubige Dorfstraße, an kleinen Häusern rechts und links vorbei, sah man unsere Dorfkirche.
Sie stand etwas erhöht auf einem Hügel und war mit ihrer Feldsteinmauer schon damals beeindruckend.
Hineingegangen war ich nie, ich glaube, auch sonst selten jemand von uns. Es war eine evangelische Kirche und unsere Familie war katholisch. Diese Unterscheidung war mir schon damals fragwürdig.
Die wichtigste Aufgabe des Kirchturms bestand darin, zur richtigen Zeit die Glocke kräftig zu läuten.
Erst sehr früh zur Weckzeit, dann zum Arbeitsbeginn, zur Mittagszeit, Vesper und zum Feierabend.
Bis auf den Feldern musste sie zu hören sein. Für besondere Anlässe wurde auch länger geläutet, wie zur Messe, Hochzeit, Beerdigung, und bei kirchlichen Feiertagen. Da wurde gebimmelt, was das Zeug hielt.
Ich bekam nie heraus, wer denn diese Aufgabe beherrschte und dachte, dass sie sehr schwer gewesen sein musste. Als ich mal danach fragte, sagte man mir: der Küster macht es.
Ich wurde durch diese Aussage auch nicht viel schlauer.
Wichtig war es aber, dass die Kirchturmuhr immer zur vollen Stunde schlug. Vielleicht auch zwischendurch viertel- und halbstündlich. Da wussten dann alle kilometerweit, was die Uhr geschlagen hatte.
Armbanduhren hatte ja