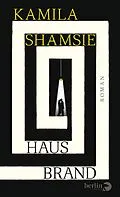Kamila Shamsie wurde 1973 in Karatschi, Pakistan, geboren und lebt in London und Karatschi. Im Berlin Verlag erschienen bisher 'Kartographie' (2004), 'Verbrannte Verse' (2005), 'Salz und Safran' (2006), 'Verglühte Schatten' (2009) und 'Die Straße der Geschichtenerzähler' (2015). Shamsie schreibt regelmäßig für den 'Guardian' und erhielt für ihr literarisches Werk zahlreiche Preise, u. a. wurde sie 2013 als 'Granta Best of Young British Novelists' ausgezeichnet. Für ihren Roman 'Hausbrand' wurde ihr der renommierte Women's Prize for Fiction verliehen.
>Sicherheit< der Engländer geht ...
Was ist Recht? Was Gerechtigkeit? Um diesen Konflikt, der uns seit Sophokles' Antigone beschäftigt , hat Kamila Shamsie einen herzzerreißenden Roman geschrieben.
Autorentext
Kamila Shamsie wurde 1973 in Karatschi, Pakistan, geboren und lebt in London und Karatschi. Im Berlin Verlag erschienen bisher "Kartographie" (2004), "Verbrannte Verse" (2005), "Salz und Safran" (2006), "Verglühte Schatten" (2009) und "Die Straße der Geschichtenerzähler" (2015). Shamsie schreibt regelmäßig für den "Guardian" und erhielt für ihr literarisches Werk zahlreiche Preise, u. a. wurde sie 2013 als "Granta Best of Young British Novelists" ausgezeichnet. Für ihren Roman "Hausbrand" wurde ihr der renommierte Women's Prize for Fiction verliehen.
Leseprobe
2 Den ganzen Morgen über tat sie so, als würde sie nicht bemerken, dass er im Souterrain des Cafés auf der anderen Seite des Raumes saß und ein Kreuzworträtsel löste.
Aber als sie sich zum Lunch ein Sandwich holte und an ihren Tisch brachte, kam er herüber und sagte, er wolle sich auch gerade einen Happen holen und ob es in Ordnung sei, wenn er sich zu ihr setzte.
»Preston Road«, sagte er, als er ein paar Minuten später mit einem Teller Pasta zurückkam. »Das kam mir irgendwie bekannt vor, als Sie sagten, dass Sie dort aufgewachsen sind, aber ich wusste nicht, warum, bis ich auf dem Stadtplan nachgeschaut habe. Das ist in Wembley. Die Familie meines Vaters wohnt da irgendwo. Ich war jedes Jahr zum Opferfest zu Besuch.«
»Ach, tatsächlich?«, sagte sie und beschloss, nicht zu erwähnen, dass sie genau wusste, wo die Familie seines Vaters gewohnt hatte, und dass sie auch wusste, was er nicht zu wissen schien, nämlich dass sie weggezogen waren, nach Kanada.
»Es gab ein Lied, das meine Cousinen immer für meine kleine Schwester gesungen haben, wenn die Erwachsenen nicht da waren. Eine Zeile ging mir jahrelang nicht aus dem Kopf. Macht mich wahnsinnig, dass ich den Rest nicht mehr zusammenkriege, und meine Schwester kann sich nicht mehr erinnern. Kennen Sie's?« Wie aus dem Nichts fing er an, einen pakistanischen Popsong aus der Zeit vor seiner Geburt zu singen - er war vier Jahre jünger als sie, wie sie herausgefunden hatte. Sie erkannte den Song eher an der Melodie als am Text, der sich nach Kauderwelsch mit ein bisschen Urdu drin anhörte. Er sang zwei Zeilen, ganz sanft, er wurde rot - eine Unsicherheit, die sie, vor allem wegen seiner sehr schönen Stimme, nicht erwartet hatte. Sie rief aus der Musikbibliothek auf ihrem Handy den Song für ihn auf und beobachtete ihn dabei, wie er seine Kopfhörer einstöpselte - unverschämt teure Dinger; Parvaiz hatte sich ein solches Modell sehnlichst gewünscht. Er lauschte mit geschlossenen Augen, sein Gesichtsausdruck verriet eher Wiedererkennen als Genuss.
»Danke«, sagte er, als er fertig war. »Was heißt das genau?«
»Es ist ein Lobgesang auf hellhäutige Mädchen, die im Leben nichts zu fürchten haben, weil alle immer ihre helle Haut und ihre blauen Augen lieben werden.«
»Ja, natürlich«, sagte er lachend. »Ich wusste das mal. Sie haben es gesungen, um meine Schwester zu hänseln, aber sie hat es als Kompliment aufgefasst und hat es zu einem gemacht. Typisch meine Schwester.«
»Und Sie? Sind Sie ähnlich drauf?«
Er runzelte ein wenig die Stirn, schob die Zinken seiner Gabel in die kleinen Pastaröhrchen. »Nein, ich glaube nicht«, sagte er auf jene wenig überzeugte Art, die man von Leuten kennt, die es nicht gewohnt sind, gebeten zu werden, ihren eigenen Charakter zu beurteilen. Er hob die Gabel vors Gesicht und sog mit einem leisen Schlürfgeräusch die Pastaröhrchen in den Mund. »Oh, Entschuldigung. Normalerweise sind meine Tischmanieren besser.«
»Stört mich nicht. Können Sie Urdu?« Er schüttelte den Kopf, eine Antwort, die sein Gesang hatte ahnen lassen, und sie sagte: »Dann verstehen Sie nicht, was bai-takalufi heißt.«
Er setzte sich gerade hin und hob den Arm wie ein Schuljunge. »Das Wort kenne ich. Es bedeutet Ungezwungenheit als Ausdruck von Intimität.«
Einen Moment lang war sie erstaunt darüber, dass ein Vater, der seinem Sohn nicht einmal Grundkenntnisse in Urdu vermittelt hatte, darauf bedacht gewesen war, ihm ausgerechnet dieses Wort beizubringen. »Intimität würde ich nicht sagen. Es geht darum, sich mit jemandem wohlzufühlen. So wohl, dass man die guten Tischmanieren vergisst. Richtig verwendet, ist es eine Art Ehre, die man der anderen Person erweist, indem man sich in ihrer Gegenwart derart wohlfühlt, vor allem wenn man den anderen noch nicht lange kennt.« Die Worte purzelten aus ihr heraus, um zu verdecken, wie sich ihre Stimme an »Intimität« verhak