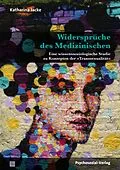Katharina Jacke zeigt am Beispiel des klinischen Konzeptes der Transsexualität, wie Depathologisierung zu einer neuen Form der Krankheit führt. Sie stellt das zeitgenössische Wissen der Medizin als genauso kontingent heraus wie die wissensproduzierenden Disziplinen selbst. Die Studie leistet somit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaftsforschung und Gender Studies einen grundlegenden empirischen Beitrag zu den Bedingungen des Denkens und der Wissensproduktion.
Wie erkennt die Medizin ihre Gegenstände, wie passt sie ihnen ihre Prozeduren an und welchen Einfluss haben wiederum die Gegenstände auf die Medizin? Am Beispiel des klinischen Konzeptes der »Transsexualität« zeigt die Autorin, wie Depathologisierung neue Formen von Krankheit hervorbringt und wie Liberalität zugleich regressiv wirken kann. Sie stellt das zeitgenössische Wissen der Medizin als genauso kontingent heraus wie die wissensproduzierenden Disziplinen selbst. Katharina Jacke untersucht das Krankheitskonzept Trans* und deckt dabei mannigfaltige Widersprüche des Denkens in der Medizin auf. Somit leistet die Studie an der Schnittstelle zwischen Wissenschaftsforschung und Gender Studies einen grundlegenden empirischen Beitrag zu den Bedingungen des Denkens und der Wissensproduktion.
Ein überzeugender Beitrag zur empirischen Wissenschaftsforschung.
Autorentext
Katharina Jacke arbeitet interdisziplinär in den Feldern Wissenssoziologie, empirische Science-Forschung und Sexualforschung. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Feministin und das Kind einer queeren Familie. Aktuell ist sie als wissenschaftliche Referentin für die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ tätig. Stand: Juni 2016
Klappentext
Inhalt
Danksagung 0. Einleitung 0.1 Die Medizin als politische Wissenschaft 15 Fragestellung Aporien der Medizin 0.2 Die Medizin zwischen Metaphysik und Phanomenologie Ludwik Fleck uber Denkstil und Denkkollektiv 0.3 Science Wars und die Frage nach der Erkenntnis von Wirklichkeit Wahrheit als Analysekategorie 0.4 Das Nature-Nurture-Problem Zuspitzung der Fragestellung 0.5 Transsexualitatsforschung 0.6 Operationalisierung 1. Transsexualitat als problematische Kategorie des Wissens: Genealogie und Horizont 1.1 Das historische Projekt Transsexualitat seit 1950: Begriffe und Diskurse 1.1.1 Transsexualitat als biologischer Befund 1.1.2 Reorganisation der Transsexualitat als psychiatrisches Konzept 1.1.3 Geschlecht als materielle Illusion oder der Geschlechtskorper als Hilfskonstrukt 1.1.4 Subjektivitat, wahres Geschlecht und bestes Geschlecht 1.1.5 Konfliktlinien und die Gender-Entwicklungstheorie in der zeitgenossischen Sexualforschung 1.1.6 Depathologisierung als Strategie sexualwissenschaftlicher Selbstbehauptung 1.2 Geschlecht als medizinische Strukturkategorie 1.2.1 Geschlechtsdifferenzierung in der zeitgenossischen Medizin 1.2.2 Das entwicklungsbiologische Stufenmodell 1.2.3 Chromosomen, Gene und Gonaden 1.2.4 Aktive Gen-Netzwerke als Antagonist_innen des Modells basic femaleness 1.2.5 Gene in Transformation: Von der mannlichen Geschlechtsumkehr zum weiblichen Mastergen 1.2.6 Das morphologische Geschlecht 1.2.7 Brainsex: Das Gehirn als bipolares System 1.2.8 Widerstreitende Wirklichkeiten des dualistischen Gehirns 1.3 Neue Wissenskategorien in epistemischen Systemen: Zwischenbilanz 2. Diversifikation der Kataloge als Strategie der Stabilisierung 2.1 Standardisierung, Objektivierung und (Qualitats-)Kontrolle 2.1.1 Norm und Abweichung, Krankheit und Gesundheit 2.1.2 Die Koppelung von Krankheit und Norm als regressives Prinzip 2.1.3 Die medizinische Norm als statistischer Wert 2.1.4 Krankheit als relatives Konstrukt in der Medizin 2.2 Die Diagnose-Klassifikationen des Geschlechtswechsels 2.2.1 Der pathologische Geschlechtswechsel in ICD und DSM 2.2.2 Die ICD-10 und der Weg Richtung ICD-11 2.2.3 Vom DSM-IV-TR zum DSM-5 2.2.4 Gender Dysphoria und Gender Incongruence Das Konzept der depathologisierten Krankheitswerte 2.3 Die Standardisierung des Transsexuellentypus (Standards of Care) 2.3.1 Die Standards der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen 2.3.2 Zur inneren Struktur der Standards 2.3.3 Kriterien der Geschlechtsmodifikation Eine Koppelung von Operation und Diagnose 2.3.4 Das Geschlecht ohne Korper 2.3.5 Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7 2.3.6 Ausdifferenzierung von gender dysphoria made in USA 2.4 Erkenntnisverfahren Standardisierung Ein regressiver Diversifikationsmotor: Zwischenbilanz 3. Zeitgenossische Behandlungspraktiken als eigentliche normative Kraft der Theoriebildung 3.1 Der Korper als operative These: Uber Bedeutungen von Operationen und operativ hergestellten Geschlechtsmerkmalen 3.1.1 Genitaloperationen 3.1.2 Brustoperationen 3.1.3 Hormonbehandlung 3.1.4 Korpermodifikationen: Zwischenbilanz 3.2 Psychologische und logopadische Interventionen als paradoxe Antithese: Von nicht-physischen und pseudo-physischen Geschlechtsmerkmalen 3.2.1 Psychotherapie des Geschlechtswechsels 3.2.2 Die Stimme Geschlecht als somatisierter Habitus 3.2.3 Von nicht-physischen und pseudo-physischen Geschlechtszeichen Aporien als Grundlage medizinischer Entscheidungsfindung: Zwischenbilanz 3.3 Neurobiologische Korrelate als Versuch der Synthese: Das transsexuelle Gehirn 3.3.1 Neurowissenschaftliche Atiologiediskussionen 3.3.2 Dimensionen neurowissenschaftlicher Forschung 3.3.3 Der Biologismus als Anti-Diskriminierungsstrategie 4. Schlussfolgerungen: Die Aporie im Spiegel vielfaltiger Binarismen 4.1 Die Macht der Binarkategorien 4.1.1 Krankheit und Gesundheit 4.1.2 Subjektivitat und Objektivitat 4.1.3 Psyche und Physis 4.1.4 Sex und Gender 4.1.5 Natur und Kultur 4.1.6 Binarismen als Hilfskategorien wissenschaftlicher Ordnung 4.2 Deregulierung und (Re-)Regulierung als Sicherung des medizinischen Interventionismus 5. Schluss Epilog Abkurzungsverzeichnis Glossar Literatur
Wie erkennt die Medizin ihre Gegenstände, wie passt sie ihnen ihre Prozeduren an und welchen Einfluss haben wiederum die Gegenstände auf die Medizin? Am Beispiel des klinischen Konzeptes der »Transsexualität« zeigt die Autorin, wie Depathologisierung neue Formen von Krankheit hervorbringt und wie Liberalität zugleich regressiv wirken kann. Sie stellt das zeitgenössische Wissen der Medizin als genauso kontingent heraus wie die wissensproduzierenden Disziplinen selbst. Katharina Jacke untersucht das Krankheitskonzept Trans* und deckt dabei mannigfaltige Widersprüche des Denkens in der Medizin auf. Somit leistet die Studie an der Schnittstelle zwischen Wissenschaftsforschung und Gender Studies einen grundlegenden empirischen Beitrag zu den Bedingungen des Denkens und der Wissensproduktion.
Ein überzeugender Beitrag zur empirischen Wissenschaftsforschung.
Autorentext
Katharina Jacke arbeitet interdisziplinär in den Feldern Wissenssoziologie, empirische Science-Forschung und Sexualforschung. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Feministin und das Kind einer queeren Familie. Aktuell ist sie als wissenschaftliche Referentin für die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ tätig. Stand: Juni 2016
Klappentext
Katharina Jacke zeigt am Beispiel des klinischen Konzeptes der >Transsexualität<, wie Depathologisierung zu einer neuen Form der Krankheit führt. Sie stellt das zeitgenössische Wissen der Medizin als genauso kontingent heraus wie die wissensproduzierenden Disziplinen selbst. Die Studie leistet somit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaftsforschung und Gender Studies einen grundlegenden empirischen Beitrag zu den Bedingungen des Denkens und der Wissensproduktion.
Inhalt
Danksagung 0. Einleitung 0.1 Die Medizin als politische Wissenschaft 15 Fragestellung Aporien der Medizin 0.2 Die Medizin zwischen Metaphysik und Phanomenologie Ludwik Fleck uber Denkstil und Denkkollektiv 0.3 Science Wars und die Frage nach der Erkenntnis von Wirklichkeit Wahrheit als Analysekategorie 0.4 Das Nature-Nurture-Problem Zuspitzung der Fragestellung 0.5 Transsexualitatsforschung 0.6 Operationalisierung 1. Transsexualitat als problematische Kategorie des Wissens: Genealogie und Horizont 1.1 Das historische Projekt Transsexualitat seit 1950: Begriffe und Diskurse 1.1.1 Transsexualitat als biologischer Befund 1.1.2 Reorganisation der Transsexualitat als psychiatrisches Konzept 1.1.3 Geschlecht als materielle Illusion oder der Geschlechtskorper als Hilfskonstrukt 1.1.4 Subjektivitat, wahres Geschlecht und bestes Geschlecht 1.1.5 Konfliktlinien und die Gender-Entwicklungstheorie in der zeitgenossischen Sexualforschung 1.1.6 Depathologisierung als Strategie sexualwissenschaftlicher Selbstbehauptung 1.2 Geschlecht als medizinische Strukturkategorie 1.2.1 Geschlechtsdifferenzierung in der zeitgenossischen Medizin 1.2.2 Das entwicklungsbiologische Stufenmodell 1.2.3 Chromosomen, Gene und Gonaden 1.2.4 Aktive Gen-Netzwerke als Antagonist_innen des Modells basic femaleness 1.2.5 Gene in Transformation: Von der mannlichen Geschlechtsumkehr zum weiblichen Mastergen 1.2.6 Das morphologische Geschlecht 1.2.7 Brainsex: Das Gehirn als bipolares System 1.2.8 Widerstreitende Wirklichkeiten des dualistischen Gehirns 1.3 Neue Wissenskategorien in epistemischen Systemen: Zwischenbilanz 2. Diversifikation der Kataloge als Strategie der Stabilisierung 2.1 Standardisierung, Objektivierung und (Qualitats-)Kontrolle 2.1.1 Norm und Abweichung, Krankheit und Gesundheit 2.1.2 Die Koppelung von Krankheit und Norm als regressives Prinzip 2.1.3 Die medizinische Norm als statistischer Wert 2.1.4 Krankheit als relatives Konstrukt in der Medizin 2.2 Die Diagnose-Klassifikationen des Geschlechtswechsels 2.2.1 Der pathologische Geschlechtswechsel in ICD und DSM 2.2.2 Die ICD-10 und der Weg Richtung ICD-11 2.2.3 Vom DSM-IV-TR zum DSM-5 2.2.4 Gender Dysphoria und Gender Incongruence Das Konzept der depathologisierten Krankheitswerte 2.3 Die Standardisierung des Transsexuellentypus (Standards of Care) 2.3.1 Die Standards der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen 2.3.2 Zur inneren Struktur der Standards 2.3.3 Kriterien der Geschlechtsmodifikation Eine Koppelung von Operation und Diagnose 2.3.4 Das Geschlecht ohne Korper 2.3.5 Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7 2.3.6 Ausdifferenzierung von gender dysphoria made in USA 2.4 Erkenntnisverfahren Standardisierung Ein regressiver Diversifikationsmotor: Zwischenbilanz 3. Zeitgenossische Behandlungspraktiken als eigentliche normative Kraft der Theoriebildung 3.1 Der Korper als operative These: Uber Bedeutungen von Operationen und operativ hergestellten Geschlechtsmerkmalen 3.1.1 Genitaloperationen 3.1.2 Brustoperationen 3.1.3 Hormonbehandlung 3.1.4 Korpermodifikationen: Zwischenbilanz 3.2 Psychologische und logopadische Interventionen als paradoxe Antithese: Von nicht-physischen und pseudo-physischen Geschlechtsmerkmalen 3.2.1 Psychotherapie des Geschlechtswechsels 3.2.2 Die Stimme Geschlecht als somatisierter Habitus 3.2.3 Von nicht-physischen und pseudo-physischen Geschlechtszeichen Aporien als Grundlage medizinischer Entscheidungsfindung: Zwischenbilanz 3.3 Neurobiologische Korrelate als Versuch der Synthese: Das transsexuelle Gehirn 3.3.1 Neurowissenschaftliche Atiologiediskussionen 3.3.2 Dimensionen neurowissenschaftlicher Forschung 3.3.3 Der Biologismus als Anti-Diskriminierungsstrategie 4. Schlussfolgerungen: Die Aporie im Spiegel vielfaltiger Binarismen 4.1 Die Macht der Binarkategorien 4.1.1 Krankheit und Gesundheit 4.1.2 Subjektivitat und Objektivitat 4.1.3 Psyche und Physis 4.1.4 Sex und Gender 4.1.5 Natur und Kultur 4.1.6 Binarismen als Hilfskategorien wissenschaftlicher Ordnung 4.2 Deregulierung und (Re-)Regulierung als Sicherung des medizinischen Interventionismus 5. Schluss Epilog Abkurzungsverzeichnis Glossar Literatur
Titel
Widersprüche des Medizinischen
Untertitel
Eine wissenssoziologische Studie zu Konzepten der »Transsexualität«
Autor
EAN
9783837972276
ISBN
978-3-8379-7227-6
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Herausgeber
Genre
Veröffentlichung
01.08.2016
Digitaler Kopierschutz
frei
Dateigrösse
7.34 MB
Anzahl Seiten
394
Untertitel
Deutsch
Auflage
1. Auflage 2016
Lesemotiv
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.