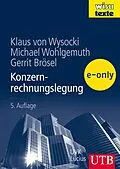Im Konzernabschluss muss der Konzern so dargestellt werden, als ob es sich bei diesem um ein Unternehmen handelt. Die Autoren erklären auf anschauliche Weise, wie hierbei nach HGB und nach IFRS vorzugehen ist und die damit verbundenen Probleme strukturiert gelöst werden können. Bei der Neuauflage dieses Klassikers stand - neben der inhaltlichen Aktualisierung - die Didaktik im Mittelpunkt: über 150 praktische Beispiele, mehr als 70 Abbildungen, Merksätze, konkrete Lernziele und individuelle Literaturhinweise runden das Buch ab. Das Buch richtet sich an Studenten, Dozenten und Praktiker. Fazit: Dieses Werk stellt nicht nur den idealen Begleiter zur zielorientierten Prüfungsvorbereitung dar, sondern eignet sich auch hervorragend zum Selbststudium.
Autorentext
Prof. Dr. Gerrit Brösel ist Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsprüfung, an der FernUniversität in Hagen.
Inhalt
Vorwort V Inhaltsübersicht VII Abkürzungsverzeichnis XXI Abbildungsverzeichnis XXVII I Grundlagen der Konzernrechnungslegung 1 1 Konzernbegriff 3 2 Regelungsüberblick und Entwicklungen 4 3 Adressaten und Zwecke 8 4 Konzerntheorien und Grundsätze 10 4.1 Generalnorm, Einheitsfiktion und Konzerntheorien 10 4.2 Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Wesentlichkeit 16 4.3 Grundsätze der Vollständigkeit und des einheitlichen Ansatzes 18 4.4 Grundsatz der einheitlichen Bewertung 23 4.4.1 Überblick 23 4.4.2 Umbewertung bei Abweichung der Wertansätze 25 4.4.3 Ausnahmen 26 4.5 Grundsatz des einheitlichen Ausweises 27 4.6 Grundsatz der Stetigkeit 28 4.7 Grundsatz der Stichtagseinheitlichkeit 29 4.7.1 Überblick 29 4.7.2 Stichtagsabweichungen 30 4.8 Sonstige bedeutende Grundsätze 34 5 Aufstellung, Prüfung, Vorlage und Offenlegung 34 5.1 Aufstellung 34 5.2 Prüfung 39 5.2.1 Prüfung des Konzernabschlusses 39 5.2.2 Prüfung der Abschlüsse der Tochterunternehmen 41 5.3 Vorlage 42 5.4 Offenlegung 43 II Verpflichtung zur Aufstellung von Konzernabschlüssen 47 1 Verpflichtung zur Aufstellung von Gesamtkonzernabschlüssen 49 1.1 Überblick 49 1.2 Grundvoraussetzungen der handelsrechtlichen Aufstellungspflicht 51 1.3 Möglichkeit der Beherrschung 51 1.3.1 Überblick 51 1.3.2 Stimmrechtsmehrheit 54 1.3.3 Organbestellungsrecht 56 1.3.4 Beherrschungsvertrag oder Satzungsbestimmung 57 1.3.5 Zweckgesellschaften 58 1.3.6 Zurechnung von Rechten 61 1.3.7 Weitere Beherrschungssachverhalte 64 1.4 Befreiungen von der Aufstellung 65 1.4.1 Überblick 65 1.4.2 Befreiung mangels konsolidierungspflichtiger Tochterunternehmen 66 1.4.3 Größenabhängige Befreiung 66 1.4.4 Befreiung durch Konzernabschluss nach internationalen Normen 70 1.5 Aufstellungspflicht und Befreiungstatbestände nach IFRS 71 2 Konsolidierungskreis 73 2.1 Überblick 73 2.2 Einbeziehungspflicht 74 2.3 Einbeziehungswahlrechte 76 2.3.1 Überblick und Konsequenzen 76 2.3.2 Beschränkungen der Rechte des Mutterunternehmens 76 2.3.3 Unverhältnismäßig hohe Kosten oder Verzögerungen in der Angabenbeschaffung 78 2.3.4 Weiterveräußerungsabsicht 79 2.3.5 Untergeordnete Bedeutung 80 2.4 Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach IFRS 81 3 Verpflichtung zur Aufstellung von Teilkonzernabschlüssen 83 3.1 Teilkonzernabschlüsse im HGB 83 3.1.1 Überblick 83 3.1.2 Befreiende Konzernabschlüsse von Mutterunternehmen mit Sitz in Deutschland, der EU bzw. dem EWR 85 3.1.2.1 Überblick 85 3.1.2.2 Offenlegung des befreienden Konzernabschlusses 87 3.1.2.3 Anforderungen an den befreienden Konzernabschluss 87 3.1.2.4 Ausnahmen von der Befreiung 89 3.1.3 Befreiende Konzernabschlüsse von Mutterunternehmen mit Sitz außerhalb der EU bzw. des EWR 90 3.1.3.1 Überblick 90 3.1.3.2 Offenlegung des befreienden Konzernabschlusses 93 3.1.3.3 Anforderungen an den befreienden Konzernabschluss 93 3.1.3.4 Ausnahmen von der Befreiung 95 3.2 Teilkonzernabschlüsse nach IFRS 95 4 Exkurs: Konzernabschlüsse nach dem Publizitätsgesetz 95 4.1 Überblick 95 4.2 Verpflichtung zur Erstellung von Gesamtkonzernabschlüssen 96 4.3 Verpflichtung zur Erstellung von Teilkonzernabschlüssen 99 III Kapitalkonsolidierung 101 1 Grundlagen 103 1.1 Zweck der Kapitalkonsolidierung 103 1.2 Gegenstand der Kapitalkonsolidierung 103 1.2.1 Gesetzliche Regelung 103 1.2.2 Anteile des Mutterunternehmens an einbezogenen Unternehmen 104 1.2.2.1 (Ir-)Relevanz der Rechtsform des einbezogenen Unternehmens 104 1.2.2.2 (Ir-)Relevanz des Ausweises der Anteile 105 1.2.2.3 Relevanter Wertansatz der Anteile 105 1.2.2.4 Zurechnung der Anteile 105 1.2.2.5 Eigene Anteile und Rückbeteiligungen 106 1.2.2.6 Gegenseitige Beteiligungen 109 1.2.3 Konsolidierungspflichtiges Kapital der einbezogenen Unternehmen 110 1.3 Erwerbs- vs. Interessenzusammenführungsmethode 113 2 Vollkonsolidierung 114 2.1 Überblick 114 2.1.1 Grundgedanken der Erwerbsmethode 114 2.1.2 Ausprägungen der Erwerbsmethode (Buchwert- vs. Neubewertungsmethode im Überblick) 115 2.1.3 Ursachen für den Unterschied zwischen dem Beteiligungsbuchwert und dem konsolidierungspflichtigen Kapital 118 2.1.4 Zeitpunkt der Erstkonsolidierung 119 2.2 Erstkonsolidierung von Tochterunternehmen ohne Beteiligung anderer Gesellschafter (100%ige Beteiligung) 121 2.2.1 Buchwertmethode 121 2.2.1.1 Vorgehensweise 121 2.2.1.2 Aufrechnung des Beteiligungsbuchwertes und des konsolidierungspflichtigen Eigenkapitals 121 2.2.1.3 Verteilung der sich ergebenden Aufrechnungsdifferenzen unter Berücksichtigung der stillen Reserven und Lasten 122 2.2.1.3.1 Aufdeckung stiller Reserven und Lasten 122 2.2.1.3.2 Bilanzansatzkorrekturen 123 2.2.1.3.3 Verteilung des Unterschiedsbetrags 124 2.2.1.4 Erstellung der Konzernbilanz 124 2.2.1.5 Beispielhafter Konsolidierungsfall 125 2.2.2 Neubewertungsmethode 128 2.2.2.1 Vorgehensweise 128 2.2.2.2 Neubewertung des Eigenkapitals 128 2.2.2.3 Aufrechnung des Beteiligungsbuchwertes und des neu bewerteten Eigenkapitals sowie Erstellung der Konzernbilanz 130 2.2.2.4 Beispielhafter Konsolidierungsfall 131 2.3 Folgekonsolidierung von Tochterunternehmen ohne Beteiligung anderer Gesellschafter (100%ige Beteiligung) 132 2.3.1 Fortschreibung der Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden aus der Erstkonsolidierung 132 2.3.2 Folgebehandlung des nicht aufgeteilten Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung 134 2.3.2.1 Behandlung eines aktiven Unterschiedsbetrags 134 2.3.2.1.1 Ausweis in der Konzernbilanz 134 2.3.2.1.2 Planmäßige Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes 134 2.3.2.1.3 Außerplanmäßige Abschreibung des Geschäftsoder Firmenwertes 136 2.3.2.2 Folgebehandlung eines passiven Unterschiedsbetrags 136 2.3.2.2.1 Ausweis in der Konzernbilanz 136 2.3.2.2.2 Erfolgswirksame Auflösung bei Eintritt der erwarteten ungünstigen Ergebnisentwicklung 137 2.3.2.2.3 Erfolgswirksame Auflösung bei Gewinnrealisierung 137 2.3.2.3 Saldierung aktiver und passiver Unterschiedsbeträge 138 2.3.3 Veränderung der für die Kapitalkonsolidierung relevanten Größen 138 2.3.4 Fortsetzung des beispielhaften Konsolidierungsfalls 141 2.4 Besonderheiten der Kapitalkonsolidierung bei Beteiligung anderer Gesellschafter 144 2.4.1 Grundproblematik 144 2.4.2 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 145 2.4.2.1 Ausweis des Ausgleichspostens 145 2.4.2.2 Zusammensetzung des Ausgleichspostens 146 2.4.3 Auswirkungen der Anteile anderer Gesellschafter auf die Ausgestaltung der Buchwertmethode 147 2.4.3.1 Abstrakte Darstellung der Auswirkungen 147 2.4.3.1.1 Erstkonsolidierung 147 2.4.3.1.2 Folgekonsolidierung 148 2.4.3.2 Beispielhafte Darstellung der Auswirkungen 149 2.4.4 Auswirkungen der Anteile anderer Gesellschafter auf die Ausgestaltung der Neubewertungsmethode 152 2.4.4.1 Abstrakte Darstellung der Auswirkungen 152 2.4.4.2 Beispielhafte Darstellung der Auswirkungen 153 2.5 Kapitalkonsolidierung im mehrstufigen Konzern 154 2.5.1 Überblick 154 2.5.2 Kettenkonsolidierung 155 2.5.2.1 Anwendung der Buchwertmethode 155 2.5.2.2 Anwendung der Neubewertungsmethode 158 2.5.3 Simultankonsolidierung 160 2.5.3.1 Gleichungsverfahren 160 2.5.3.2 Matrizenrechnung…
Autorentext
Prof. Dr. Gerrit Brösel ist Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsprüfung, an der FernUniversität in Hagen.
Inhalt
Vorwort V Inhaltsübersicht VII Abkürzungsverzeichnis XXI Abbildungsverzeichnis XXVII I Grundlagen der Konzernrechnungslegung 1 1 Konzernbegriff 3 2 Regelungsüberblick und Entwicklungen 4 3 Adressaten und Zwecke 8 4 Konzerntheorien und Grundsätze 10 4.1 Generalnorm, Einheitsfiktion und Konzerntheorien 10 4.2 Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Wesentlichkeit 16 4.3 Grundsätze der Vollständigkeit und des einheitlichen Ansatzes 18 4.4 Grundsatz der einheitlichen Bewertung 23 4.4.1 Überblick 23 4.4.2 Umbewertung bei Abweichung der Wertansätze 25 4.4.3 Ausnahmen 26 4.5 Grundsatz des einheitlichen Ausweises 27 4.6 Grundsatz der Stetigkeit 28 4.7 Grundsatz der Stichtagseinheitlichkeit 29 4.7.1 Überblick 29 4.7.2 Stichtagsabweichungen 30 4.8 Sonstige bedeutende Grundsätze 34 5 Aufstellung, Prüfung, Vorlage und Offenlegung 34 5.1 Aufstellung 34 5.2 Prüfung 39 5.2.1 Prüfung des Konzernabschlusses 39 5.2.2 Prüfung der Abschlüsse der Tochterunternehmen 41 5.3 Vorlage 42 5.4 Offenlegung 43 II Verpflichtung zur Aufstellung von Konzernabschlüssen 47 1 Verpflichtung zur Aufstellung von Gesamtkonzernabschlüssen 49 1.1 Überblick 49 1.2 Grundvoraussetzungen der handelsrechtlichen Aufstellungspflicht 51 1.3 Möglichkeit der Beherrschung 51 1.3.1 Überblick 51 1.3.2 Stimmrechtsmehrheit 54 1.3.3 Organbestellungsrecht 56 1.3.4 Beherrschungsvertrag oder Satzungsbestimmung 57 1.3.5 Zweckgesellschaften 58 1.3.6 Zurechnung von Rechten 61 1.3.7 Weitere Beherrschungssachverhalte 64 1.4 Befreiungen von der Aufstellung 65 1.4.1 Überblick 65 1.4.2 Befreiung mangels konsolidierungspflichtiger Tochterunternehmen 66 1.4.3 Größenabhängige Befreiung 66 1.4.4 Befreiung durch Konzernabschluss nach internationalen Normen 70 1.5 Aufstellungspflicht und Befreiungstatbestände nach IFRS 71 2 Konsolidierungskreis 73 2.1 Überblick 73 2.2 Einbeziehungspflicht 74 2.3 Einbeziehungswahlrechte 76 2.3.1 Überblick und Konsequenzen 76 2.3.2 Beschränkungen der Rechte des Mutterunternehmens 76 2.3.3 Unverhältnismäßig hohe Kosten oder Verzögerungen in der Angabenbeschaffung 78 2.3.4 Weiterveräußerungsabsicht 79 2.3.5 Untergeordnete Bedeutung 80 2.4 Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach IFRS 81 3 Verpflichtung zur Aufstellung von Teilkonzernabschlüssen 83 3.1 Teilkonzernabschlüsse im HGB 83 3.1.1 Überblick 83 3.1.2 Befreiende Konzernabschlüsse von Mutterunternehmen mit Sitz in Deutschland, der EU bzw. dem EWR 85 3.1.2.1 Überblick 85 3.1.2.2 Offenlegung des befreienden Konzernabschlusses 87 3.1.2.3 Anforderungen an den befreienden Konzernabschluss 87 3.1.2.4 Ausnahmen von der Befreiung 89 3.1.3 Befreiende Konzernabschlüsse von Mutterunternehmen mit Sitz außerhalb der EU bzw. des EWR 90 3.1.3.1 Überblick 90 3.1.3.2 Offenlegung des befreienden Konzernabschlusses 93 3.1.3.3 Anforderungen an den befreienden Konzernabschluss 93 3.1.3.4 Ausnahmen von der Befreiung 95 3.2 Teilkonzernabschlüsse nach IFRS 95 4 Exkurs: Konzernabschlüsse nach dem Publizitätsgesetz 95 4.1 Überblick 95 4.2 Verpflichtung zur Erstellung von Gesamtkonzernabschlüssen 96 4.3 Verpflichtung zur Erstellung von Teilkonzernabschlüssen 99 III Kapitalkonsolidierung 101 1 Grundlagen 103 1.1 Zweck der Kapitalkonsolidierung 103 1.2 Gegenstand der Kapitalkonsolidierung 103 1.2.1 Gesetzliche Regelung 103 1.2.2 Anteile des Mutterunternehmens an einbezogenen Unternehmen 104 1.2.2.1 (Ir-)Relevanz der Rechtsform des einbezogenen Unternehmens 104 1.2.2.2 (Ir-)Relevanz des Ausweises der Anteile 105 1.2.2.3 Relevanter Wertansatz der Anteile 105 1.2.2.4 Zurechnung der Anteile 105 1.2.2.5 Eigene Anteile und Rückbeteiligungen 106 1.2.2.6 Gegenseitige Beteiligungen 109 1.2.3 Konsolidierungspflichtiges Kapital der einbezogenen Unternehmen 110 1.3 Erwerbs- vs. Interessenzusammenführungsmethode 113 2 Vollkonsolidierung 114 2.1 Überblick 114 2.1.1 Grundgedanken der Erwerbsmethode 114 2.1.2 Ausprägungen der Erwerbsmethode (Buchwert- vs. Neubewertungsmethode im Überblick) 115 2.1.3 Ursachen für den Unterschied zwischen dem Beteiligungsbuchwert und dem konsolidierungspflichtigen Kapital 118 2.1.4 Zeitpunkt der Erstkonsolidierung 119 2.2 Erstkonsolidierung von Tochterunternehmen ohne Beteiligung anderer Gesellschafter (100%ige Beteiligung) 121 2.2.1 Buchwertmethode 121 2.2.1.1 Vorgehensweise 121 2.2.1.2 Aufrechnung des Beteiligungsbuchwertes und des konsolidierungspflichtigen Eigenkapitals 121 2.2.1.3 Verteilung der sich ergebenden Aufrechnungsdifferenzen unter Berücksichtigung der stillen Reserven und Lasten 122 2.2.1.3.1 Aufdeckung stiller Reserven und Lasten 122 2.2.1.3.2 Bilanzansatzkorrekturen 123 2.2.1.3.3 Verteilung des Unterschiedsbetrags 124 2.2.1.4 Erstellung der Konzernbilanz 124 2.2.1.5 Beispielhafter Konsolidierungsfall 125 2.2.2 Neubewertungsmethode 128 2.2.2.1 Vorgehensweise 128 2.2.2.2 Neubewertung des Eigenkapitals 128 2.2.2.3 Aufrechnung des Beteiligungsbuchwertes und des neu bewerteten Eigenkapitals sowie Erstellung der Konzernbilanz 130 2.2.2.4 Beispielhafter Konsolidierungsfall 131 2.3 Folgekonsolidierung von Tochterunternehmen ohne Beteiligung anderer Gesellschafter (100%ige Beteiligung) 132 2.3.1 Fortschreibung der Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden aus der Erstkonsolidierung 132 2.3.2 Folgebehandlung des nicht aufgeteilten Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung 134 2.3.2.1 Behandlung eines aktiven Unterschiedsbetrags 134 2.3.2.1.1 Ausweis in der Konzernbilanz 134 2.3.2.1.2 Planmäßige Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes 134 2.3.2.1.3 Außerplanmäßige Abschreibung des Geschäftsoder Firmenwertes 136 2.3.2.2 Folgebehandlung eines passiven Unterschiedsbetrags 136 2.3.2.2.1 Ausweis in der Konzernbilanz 136 2.3.2.2.2 Erfolgswirksame Auflösung bei Eintritt der erwarteten ungünstigen Ergebnisentwicklung 137 2.3.2.2.3 Erfolgswirksame Auflösung bei Gewinnrealisierung 137 2.3.2.3 Saldierung aktiver und passiver Unterschiedsbeträge 138 2.3.3 Veränderung der für die Kapitalkonsolidierung relevanten Größen 138 2.3.4 Fortsetzung des beispielhaften Konsolidierungsfalls 141 2.4 Besonderheiten der Kapitalkonsolidierung bei Beteiligung anderer Gesellschafter 144 2.4.1 Grundproblematik 144 2.4.2 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 145 2.4.2.1 Ausweis des Ausgleichspostens 145 2.4.2.2 Zusammensetzung des Ausgleichspostens 146 2.4.3 Auswirkungen der Anteile anderer Gesellschafter auf die Ausgestaltung der Buchwertmethode 147 2.4.3.1 Abstrakte Darstellung der Auswirkungen 147 2.4.3.1.1 Erstkonsolidierung 147 2.4.3.1.2 Folgekonsolidierung 148 2.4.3.2 Beispielhafte Darstellung der Auswirkungen 149 2.4.4 Auswirkungen der Anteile anderer Gesellschafter auf die Ausgestaltung der Neubewertungsmethode 152 2.4.4.1 Abstrakte Darstellung der Auswirkungen 152 2.4.4.2 Beispielhafte Darstellung der Auswirkungen 153 2.5 Kapitalkonsolidierung im mehrstufigen Konzern 154 2.5.1 Überblick 154 2.5.2 Kettenkonsolidierung 155 2.5.2.1 Anwendung der Buchwertmethode 155 2.5.2.2 Anwendung der Neubewertungsmethode 158 2.5.3 Simultankonsolidierung 160 2.5.3.1 Gleichungsverfahren 160 2.5.3.2 Matrizenrechnung…
Titel
Konzernrechnungslegung
EAN
9783838585581
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
22.01.2014
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
500
Auflage
5. Auflage
Lesemotiv
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.