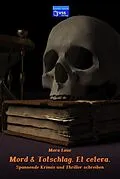Krimis und Thriller sind das beliebteste Genre des Lesepublikums. Doch sie zu schreiben hat seine Tücken. Die Logik des Verbrechens ist ebenso essenziell wie die Vermeidung von Klischees. Die Psychologie von Tätern und Opfern ist ebenso wichtig wie die Glaubwürdigkeit der Figuren. In diesem Schreibratgeber verrät die erfolgreiche Krimiautorin Mara Laue, wie gute Krimi- und Thrillerhandlungen aufgebaut werden, wie Spannung erzeugt und gesteigert wird, welchen Einfluss die Perspektive auf die Handlung hat und vieles mehr. Kapitel über die Entstehungsgeschichte des Kriminalromans und eine Übersicht über die gängigsten Subgenres runden das Buch ab. Ein Sonderkapitel erläutert ausführlich die reale Polizeiarbeit und beantwortet viele Fragen, die sich nicht nur Krimischreibenden stellen. Ein Must-have für alle, die Krimis/Thriller schreiben wollen, welche sich positiv von der Masse abheben.
Leseprobe
1. Kain und Abel: die Ursprünge des Kriminalromans Verbrechen gibt es, seit in grauer Vorzeit die Vorfahren der heutigen Menschen die Moral entwickelten und die ersten Definitionen von Recht und Unrecht festlegten. Auch deren künstlerische Verarbeitung hat eine lange Tradition. Zunächst finden wir sie in überlieferten Mythen, Märchen und Sagen, bei denen es teilweise recht blutig zugeht. Besonders in den Märchen, die im Gegensatz zu Sagen und Legenden, welche einen wahren Kern enthalten, frei erfunden sind, werden reihenweise Verbrechen begangen. Sie reichen von Diebstählen, Intrigen, Betrug, üblen Zaubereien und sonstigen Hinterlisten bis hin zu Verstümmelungen, Morden und Mordversuchen. Auch viele Stücke des antiken Theaters, das seine Blütezeit im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erlebte, thematisieren Verbrechen, deren Verfolgung und Sühne. In der dreiteiligen Ore-stie von Aischylos (525-456 vor unserer Zeitrechnung) geht es um den von Orestes' Mutter Klytaimnestra an ihrem Mann Agamemnon begangenen Mord, den Orestes rächt, indem er seine Mutter und deren Liebhaber Aigisthos erschlägt und sich am Ende vor den drei Rachegöttinnen, den Erinyen, dafür verantworten muss. König Ödipus von Sophokles (497-406 vor unserer Zeitrechnung) besteht gleich aus einer ganzen Reihe von Verbrechen. Weil ein Orakel dem König von Theben weissagte, dass sein Sohn ihn eines Tages erschlagen und die eigene Mutter heiraten werde, beauftragt er einen Diener, das Baby zu töten (Mord). Der lässt es zwar am Leben, setzt es aber aus. Ödipus wird gefunden und von einer anderen Familie aufgezogen. Eines Tages gerät er als Erwachsener mit einem Fremden in Streit und erschlägt ihn (Totschlag) ohne zu wissen, dass dieser Mann sein leiblicher Vater ist. Weil Ödipus dessen Heimatstadt von der todbringenden Sphinx befreien kann, bekommt er die Königin zur Frau nicht ahnend, dass sie seine leibliche Mutter ist und zeugt Kinder mit ihr (Inzest). Doch am Ende kommt das Ganze ans Licht, und die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. In Medea von Euripides (480-406 vor unserer Zeitrechnung) geht es um von ihr begangenen Betrug mit Todesfolge, blutige Scheidung mit mehrfachem Mord einschließlich Tötung der eigenen Kinder. Medea flieht, und ihre Taten bleiben ungesühnt. Die Tradition, Verbrechen nicht nur in Theaterstücken, sondern auch in Gemälden und Skulpturen zu verarbeiten, ist wirklich alt. Darüber, wer sich rühmen darf, den ersten Kriminalroman geschrieben zu haben, streiten sich die Geister. Unter anderem deshalb, weil sich derartige Überlegungen in der Regel ausschließlich auf die westliche Welt beziehen und die vielen Erzählungen und Romane der orientalischen und asiatischen Literatur außer Acht lassen. Belegt ist, dass der Römer Cicero (106-43 vor unserer Zeitrechnung), der nicht nur Staatsmann, sondern auch Anwalt war, seine Plädoyers veröffentlichte und diese von der Bevölkerung als Unterhaltungsliteratur gelesen wurden, obwohl es sich um Sachtexte handelte. Im Mittelalter beschränkten sich spannende Erzählungen zunächst auf mündliche Berichte über wahre Verbrechen, die von fahrenden Sängern (Bänkelsängern) vorgetragen wurden, weil der Großteil der Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnte. Schon bald wurden diese Geschichten aber ausgeschmückt, um ihre Spannung und das Gruseln beim Publikum zu steigern und dementsprechend auch die Einnahmen der Vortragenden zu erhöhen. Mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert kamen auch echte Kriminalgeschichten auf den Markt. Als eine der ersten kann die Fabel Reineke Fuchs gelten, die 1498 zum ersten Mal gedruckt veröffentlicht wurde. Darin ist Reineke, der Fuchs, ein Berufsverbrecher, der vor König Nobel (einem Löwen) erscheinen und abgeurteilt werden soll. Nachdem er die Boten des Königs beinahe getötet hat (fahrlässige Tötung beziehungsweise Mordversuch sowie späterer Mord am Hasen Meister Lampe), wird er zwangsvorgeladen und zum Tode verurteilt. Reineke gelingt zunächst, sich mit hanebüchenen Lügengeschichten aus der Bredouille zu winden. Als danach sein Mord am Hasen entdeckt wird, kommt es zu einer zweiten Gerichtsverhandlung und einem neuen Todesurteil, das der Wolf in einem Zweikampf mit Reineke vollstrecken soll. Reineke gewinnt entgegen allen Erwartungen, wodurch er nicht nur freikommt, sondern vom König auch zu seinem Berater ernannt wird. Krimi pur! Weil Reineke Fuchs aber als Fabel1 gilt, wird die Geschichte nicht als Kriminalroman beziehungsweise Kriminalgeschichte gewertet. Obwohl sie keine Romane oder Kurzgeschichten, sondern Gerichtsprotokolle waren, erfreuten sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts True Crime-Berichte aus den Gerichtssälen reißenden Absatzes. Sie wurden in Buchform veröffentlicht und regelmäßig zu Bestsellern, obwohl ihre literarische und sprachliche Qualität kein besonders hohes Niveau besaß. Sie waren eben Sachtexte, auch wenn in ihnen teilweise die Aussagen einzelner Personen in direkter (wörtlicher) Rede wiedergegeben wurden. Eines der ersten fiktiven deutschsprachigen Werke war Friedrich Schillers (1759-1805) Bericht Der Verbrecher aus verlorener Ehre, der 1786 veröffentlicht wurde. In Theaterstücken wurden Verbrechen ebenfalls immer beliebter. Bereits William Shakespeares (1564-1616) Dramen triefen förmlich von Mord und Totschlag (Hamlet, Macbeth, Romeo und Julia und etliche andere). Aber auch im deutschsprachigen Raum gab es zunehmend Bühnendramen, deren Handlung sich um Verbrechen drehte, sowie Novellen2 (die man durchaus zu den Romanen zählen kann) mit entsprechendem Inhalt. Friedrich Schillers späteres Theaterstück Die Räuber wurde 1781 zunächst als Lesestück = Prosatext veröffentlicht und 1782 als Theaterstück uraufgeführt. Der Inhalt ist eine Kain-und-Abel-Geschichte um die Rivalität und Missgunst zwischen zwei Brüdern. 1810 schrieb Heinrich von Kleist seine Erzählung Michael Kohlhaas, in der es um Selbstjustiz geht. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, die Kleist literarisch ausschmückte. 1819 wurde Das Fräulein von Scuderi von Ernst Theodor Wilhelm (E.T.A.3) Hoffmann (1776-1822) erstmalig veröffentlicht. Darin geht es um eine Mordserie im Paris des Jahres 1680. Die Heldin, Mademoiselle Madeleine Scuderi, 73 Jahre alt, hat durchaus Ähnlichkeiten mit Agatha Christies Miss Marple. 1842 schrieb Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) Die Judenbuche, die den Mord an einem unter einer Buche getöteten Juden thematisiert. Weitere Novellen, Erzählungen und Kurzgeschichten mit mörderischem Inhalt folgten. Etwa zur gleichen Zeit (Mitte des 18. Jahrhunderts) wurde der Schauerroman populär. Als ihr Begründer, genauer gesagt der Gothic4 Novel, gilt Horace Walpole, der 4. Earl of Orford (1717-1797), dessen Roman Das Schloss von Ontaro als erster Vertreter dieses Genres gewertet wird. (Interessant: Walpole gilt auch als Begründer des typischen englischen Landschaftsgartens, worüber er ebenfalls Texte verfasste.5) Gruselgeschichten boomten besonders in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (auch etliche von Edgar Allan Poes Storys und Gedichten zählen dazu). Einer der b…
Leseprobe
1. Kain und Abel: die Ursprünge des Kriminalromans Verbrechen gibt es, seit in grauer Vorzeit die Vorfahren der heutigen Menschen die Moral entwickelten und die ersten Definitionen von Recht und Unrecht festlegten. Auch deren künstlerische Verarbeitung hat eine lange Tradition. Zunächst finden wir sie in überlieferten Mythen, Märchen und Sagen, bei denen es teilweise recht blutig zugeht. Besonders in den Märchen, die im Gegensatz zu Sagen und Legenden, welche einen wahren Kern enthalten, frei erfunden sind, werden reihenweise Verbrechen begangen. Sie reichen von Diebstählen, Intrigen, Betrug, üblen Zaubereien und sonstigen Hinterlisten bis hin zu Verstümmelungen, Morden und Mordversuchen. Auch viele Stücke des antiken Theaters, das seine Blütezeit im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erlebte, thematisieren Verbrechen, deren Verfolgung und Sühne. In der dreiteiligen Ore-stie von Aischylos (525-456 vor unserer Zeitrechnung) geht es um den von Orestes' Mutter Klytaimnestra an ihrem Mann Agamemnon begangenen Mord, den Orestes rächt, indem er seine Mutter und deren Liebhaber Aigisthos erschlägt und sich am Ende vor den drei Rachegöttinnen, den Erinyen, dafür verantworten muss. König Ödipus von Sophokles (497-406 vor unserer Zeitrechnung) besteht gleich aus einer ganzen Reihe von Verbrechen. Weil ein Orakel dem König von Theben weissagte, dass sein Sohn ihn eines Tages erschlagen und die eigene Mutter heiraten werde, beauftragt er einen Diener, das Baby zu töten (Mord). Der lässt es zwar am Leben, setzt es aber aus. Ödipus wird gefunden und von einer anderen Familie aufgezogen. Eines Tages gerät er als Erwachsener mit einem Fremden in Streit und erschlägt ihn (Totschlag) ohne zu wissen, dass dieser Mann sein leiblicher Vater ist. Weil Ödipus dessen Heimatstadt von der todbringenden Sphinx befreien kann, bekommt er die Königin zur Frau nicht ahnend, dass sie seine leibliche Mutter ist und zeugt Kinder mit ihr (Inzest). Doch am Ende kommt das Ganze ans Licht, und die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. In Medea von Euripides (480-406 vor unserer Zeitrechnung) geht es um von ihr begangenen Betrug mit Todesfolge, blutige Scheidung mit mehrfachem Mord einschließlich Tötung der eigenen Kinder. Medea flieht, und ihre Taten bleiben ungesühnt. Die Tradition, Verbrechen nicht nur in Theaterstücken, sondern auch in Gemälden und Skulpturen zu verarbeiten, ist wirklich alt. Darüber, wer sich rühmen darf, den ersten Kriminalroman geschrieben zu haben, streiten sich die Geister. Unter anderem deshalb, weil sich derartige Überlegungen in der Regel ausschließlich auf die westliche Welt beziehen und die vielen Erzählungen und Romane der orientalischen und asiatischen Literatur außer Acht lassen. Belegt ist, dass der Römer Cicero (106-43 vor unserer Zeitrechnung), der nicht nur Staatsmann, sondern auch Anwalt war, seine Plädoyers veröffentlichte und diese von der Bevölkerung als Unterhaltungsliteratur gelesen wurden, obwohl es sich um Sachtexte handelte. Im Mittelalter beschränkten sich spannende Erzählungen zunächst auf mündliche Berichte über wahre Verbrechen, die von fahrenden Sängern (Bänkelsängern) vorgetragen wurden, weil der Großteil der Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnte. Schon bald wurden diese Geschichten aber ausgeschmückt, um ihre Spannung und das Gruseln beim Publikum zu steigern und dementsprechend auch die Einnahmen der Vortragenden zu erhöhen. Mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert kamen auch echte Kriminalgeschichten auf den Markt. Als eine der ersten kann die Fabel Reineke Fuchs gelten, die 1498 zum ersten Mal gedruckt veröffentlicht wurde. Darin ist Reineke, der Fuchs, ein Berufsverbrecher, der vor König Nobel (einem Löwen) erscheinen und abgeurteilt werden soll. Nachdem er die Boten des Königs beinahe getötet hat (fahrlässige Tötung beziehungsweise Mordversuch sowie späterer Mord am Hasen Meister Lampe), wird er zwangsvorgeladen und zum Tode verurteilt. Reineke gelingt zunächst, sich mit hanebüchenen Lügengeschichten aus der Bredouille zu winden. Als danach sein Mord am Hasen entdeckt wird, kommt es zu einer zweiten Gerichtsverhandlung und einem neuen Todesurteil, das der Wolf in einem Zweikampf mit Reineke vollstrecken soll. Reineke gewinnt entgegen allen Erwartungen, wodurch er nicht nur freikommt, sondern vom König auch zu seinem Berater ernannt wird. Krimi pur! Weil Reineke Fuchs aber als Fabel1 gilt, wird die Geschichte nicht als Kriminalroman beziehungsweise Kriminalgeschichte gewertet. Obwohl sie keine Romane oder Kurzgeschichten, sondern Gerichtsprotokolle waren, erfreuten sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts True Crime-Berichte aus den Gerichtssälen reißenden Absatzes. Sie wurden in Buchform veröffentlicht und regelmäßig zu Bestsellern, obwohl ihre literarische und sprachliche Qualität kein besonders hohes Niveau besaß. Sie waren eben Sachtexte, auch wenn in ihnen teilweise die Aussagen einzelner Personen in direkter (wörtlicher) Rede wiedergegeben wurden. Eines der ersten fiktiven deutschsprachigen Werke war Friedrich Schillers (1759-1805) Bericht Der Verbrecher aus verlorener Ehre, der 1786 veröffentlicht wurde. In Theaterstücken wurden Verbrechen ebenfalls immer beliebter. Bereits William Shakespeares (1564-1616) Dramen triefen förmlich von Mord und Totschlag (Hamlet, Macbeth, Romeo und Julia und etliche andere). Aber auch im deutschsprachigen Raum gab es zunehmend Bühnendramen, deren Handlung sich um Verbrechen drehte, sowie Novellen2 (die man durchaus zu den Romanen zählen kann) mit entsprechendem Inhalt. Friedrich Schillers späteres Theaterstück Die Räuber wurde 1781 zunächst als Lesestück = Prosatext veröffentlicht und 1782 als Theaterstück uraufgeführt. Der Inhalt ist eine Kain-und-Abel-Geschichte um die Rivalität und Missgunst zwischen zwei Brüdern. 1810 schrieb Heinrich von Kleist seine Erzählung Michael Kohlhaas, in der es um Selbstjustiz geht. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, die Kleist literarisch ausschmückte. 1819 wurde Das Fräulein von Scuderi von Ernst Theodor Wilhelm (E.T.A.3) Hoffmann (1776-1822) erstmalig veröffentlicht. Darin geht es um eine Mordserie im Paris des Jahres 1680. Die Heldin, Mademoiselle Madeleine Scuderi, 73 Jahre alt, hat durchaus Ähnlichkeiten mit Agatha Christies Miss Marple. 1842 schrieb Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) Die Judenbuche, die den Mord an einem unter einer Buche getöteten Juden thematisiert. Weitere Novellen, Erzählungen und Kurzgeschichten mit mörderischem Inhalt folgten. Etwa zur gleichen Zeit (Mitte des 18. Jahrhunderts) wurde der Schauerroman populär. Als ihr Begründer, genauer gesagt der Gothic4 Novel, gilt Horace Walpole, der 4. Earl of Orford (1717-1797), dessen Roman Das Schloss von Ontaro als erster Vertreter dieses Genres gewertet wird. (Interessant: Walpole gilt auch als Begründer des typischen englischen Landschaftsgartens, worüber er ebenfalls Texte verfasste.5) Gruselgeschichten boomten besonders in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (auch etliche von Edgar Allan Poes Storys und Gedichten zählen dazu). Einer der b…
Titel
Mord & Totschlag. Et cetera.
Untertitel
Spannende Krimis und Thriller schreiben
Autor
EAN
9783961273430
Format
E-Book (epub)
Hersteller
Veröffentlichung
21.10.2023
Digitaler Kopierschutz
frei
Dateigrösse
4.87 MB
Anzahl Seiten
365
Auflage
1. Auflage
Lesemotiv
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.