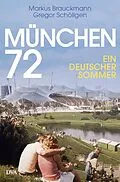Die zweiten Olympischen Sommerspiele auf deutschem Boden sind das erste Weltereignis in der Bundesrepublik: München 72 bietet die einmalige Chance, das moderne Deutschland vorzuzeigen. Für die Bundesbürger ist Olympia, was für die Amerikaner die Mondlandung war - ein Aufbruch in eine neue Zeit, dem die ganze Nation entgegenfiebert. Alle wollen zum Gelingen der Heiteren Spiele beitragen: berühmte Athleten, unbekannte Helfer, eifrige Hostessen. Es ist ihr deutscher »Summer of Love«. »München 72« erzählt die Geschichte und Geschichten hinter dem Sportfest. Von Deutschland West und Ost, von »Willy wählen« und alltäglichem Rassismus, von Mode und Musik, von Aufklärung und Sex. Von Frieden und Krieg - und vom Terroranschlag auf die israelische Mannschaft, der über Nacht die Erinnerung an Berlin 1936, die ersten Olympischen Spiele auf deutschem Boden, wachrief.
Markus Brauckmann, Jahrgang 1968, ist Autor und Regisseur. Nach Studien in Berlin und den USA arbeitete der Politologe für RTL und ProSieben sowie in mehreren Bundestagswahlkämpfen. Seine TV-Dokumentationen wurden im In- und Ausland mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Zuletzt gewann er die 'Romy' für einen Film über Niki Lauda. Markus Brauckmann lebt in Köln.
»Ein großartiges Zeitdokument ... Sie fühlen sich zurückversetzt in diese Zeit.« (WDR 2)
Die zweiten Olympischen Sommerspiele auf deutschem Boden sind das erste Weltereignis in der Bundesrepublik: München 72 bietet die einmalige Chance, das moderne Deutschland vorzuzeigen. Für die Bundesbürger ist Olympia, was für die Amerikaner die Mondlandung war ein Aufbruch in eine neue Zeit, dem die ganze Nation entgegenfiebert. Alle wollen zum Gelingen der Heiteren Spiele beitragen: berühmte Athleten, unbekannte Helfer, eifrige Hostessen. Es ist ihr deutscher »Summer of Love«. »München 72« erzählt die Geschichte und Geschichten hinter dem Sportfest. Von Deutschland West und Ost, von »Willy wählen« und alltäglichem Rassismus, von Mode und Musik, von Aufklärung und Sex. Von Frieden und Krieg und vom Terroranschlag auf die israelische Mannschaft, der über Nacht die Erinnerung an Berlin 1936, die ersten Olympischen Spiele auf deutschem Boden, wachrief.
Autoren stehen für Veranstalungen zur Verfügung
Autorentext
Gregor Schöllgen, Jahrgang 1952, lehrte von 1985 bis 2017 Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Erlangen und in der Attachéausbildung des Auswärtigen Amtes. Er wirkte als Gastprofessor in New York, Oxford, London und Zürich, war Mitherausgeber der Akten des Auswärtigen Amtes sowie des Nachlasses von Willy Brandt.Als profilierter Biograph folgte er den Spuren unter anderem von Willy Brandt, Ulrich von Hassell, Martin Herrenknecht, Gustav Schickedanz, Theo Schöller, Gerhard Schröder und Max Weber sowie von bedeutenden Unternehmerfamilien wie Brose, Diehl und Schaeffler. Zuletzt erschien bei DVA seine Geschichte der Familie Weiss und ihres Unternehmens, des Anlagenbauers SMS.
Klappentext
Die Olympischen Spiele von München in einem allumfassenden Panorama
Die zweiten Olympischen Sommerspiele auf deutschem Boden sind das erste Weltereignis in der Bundesrepublik: München 72 bietet die einmalige Chance, das moderne Deutschland vorzuzeigen. Für die Bundesbürger ist Olympia, was für die Amerikaner die Mondlandung war - ein Aufbruch in eine neue Zeit, dem die ganze Nation entgegenfiebert. Alle wollen zum Gelingen der Heiteren Spiele beitragen: berühmte Athleten, unbekannte Helfer, eifrige Hostessen. Es ist ihr deutscher »Summer of Love«. »München 72« erzählt die Geschichte und Geschichten hinter dem Sportfest. Von Deutschland West und Ost, von »Willy wählen« und alltäglichem Rassismus, von Mode und Musik, von Aufklärung und Sex. Von Frieden und Krieg - und vom Terroranschlag auf die israelische Mannschaft, der über Nacht die Erinnerung an Berlin 1936, die ersten Olympischen Spiele auf deutschem Boden, wachrief.
Leseprobe
Auf die Plätze
Ein letzter Moment der Muße im fast leeren Stadion, bevor es losgeht. Drei Themen sind in diesen Tagen in aller Munde: die neue U-Bahn, ein drohender Boykott afrikanischer Nationen und die charmanten Olympia-Hostessen. »München präsentiert die Spiele des Fräuleinwunders«, schreibt die »Abendzeitung«. »Mädchen, Mädchen, Mädchen«.
© imago sport/WEREK
Sie sind moderne, aufgeklärte Frauen. Aufgewachsen als Teenager in den wilden Sechzigern, mit Antibabypille und sexueller Revolution. Jetzt müssen sie schön brav sein. Für das große Ereignis und für ihr Land. Denn am 26. August 1972 werden in München die Spiele der XX. Olympiade der Neuzeit eröffnet. Und sie, die Hostessen, werden Besucher aus aller Welt in Empfang nehmen. Welcome to Germany!
Herrenbesuch? In ihren Unterkünften streng verboten, darüber wacht ein Angestellter der Bundeswehr. Flirten? Kaum möglich, weil die Einsatzpläne der jungen Damen randvoll sind. Und statt Minirock sieht ihre Kleiderordnung ein Dirndl und Kniestrümpfe vor. Die Mädchen von München 72 haben einen tadellosen Ruf zu wahren. »Wir wollten Deutschland gut repräsentieren«, sagt Gertrude Krombholz freundlich, aber bestimmt. »Für ungebührliches Verhalten war da kein Platz.« Die 39-Jährige aus Bayern hat einen Teil der jungen Damen ausgebildet, die für viele Teilnehmer der erste Anlaufpunkt bei den Spielen sein werden: die Olympia-Hostessen. Sie gehören zur Generation München 72, die Deutschland ein neues Gesicht geben soll. Vor den Augen der Welt, die hier zu Gast ist.
Die Verantwortlichen haben schon im Vorfeld einiges getan, um die Helferinnen perfekt auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Seit zwei Jahren laufen die Planungen. Dafür zuständig ist Doktor Emmy Schwabe, die Leiterin des Referats Besucherbetreuung und Hostessenwesen beim Organisationskomitee (OK) der Olympischen Sommerspiele 1972 in München. Um die Richtigen zu finden, will sie zunächst ein Testprogramm mit Sportstudentinnen aufsetzen. Gertrude Krombholz ist die Frau, der sie diese Aufgabe zutraut.
Die Dozentin der Bayerischen Sportakademie ist sofort Feuer und Flamme. »Ich hatte gerne mit jungen Leuten zu tun. Und mit meinen Studentinnen habe ich immer in einem Boot gesessen.« Mit dem Testprogramm und dann mit der Auswahl der jungen Frauen wird es nicht sein Bewenden haben. Krombholz bleibt als Gruppen-Chefhostess an Bord, zuständig für die Schwimmhalle. Der Freistaat Bayern stellt die Lehrkraft frei - unter Fortzahlung der Dienstbezüge.
Gemeinsam mit weiteren Kolleginnen suchen Emmy Schwabe und Gertrude Krombholz zunächst einmal »hübsche und sprachgewandte Mädchen«. Eingesetzt werden die Freiwilligen im Protokoll, bei der Betreuung der Mannschaften, an Infoständen in Hotels, am Flughafen - und bei den olympischen Wettkämpfen. Irgendjemand muss den Sportlern ja den Weg zur Umkleidekabine oder zum Siegerpodest zeigen. Über 10 000 junge Damen schauen sich die Prüferinnen näher an. Die Richtung gibt Willi Daume vor, der Chef von München 72, der noch vorzustellen ist. In einem Brief an die Hostessen legt der Präsident des Organisationskomitees seine Vorstellungen von ihrem weiblichen Wirken dar: »Hostess, Gastgeberin also, ist man. Denn im Grunde kann man es nicht erlernen. Die Fähigkeit kommt aus dem Wesen und Herzen einer Frau. Man muss sie von Hause aus mitbringen.«
Gertrude Krombholz ist - ungewöhnlich in diesen Jahren - unverheiratet und kinderlos (»Ich war glücklich in meinem anspruchsvollen Beruf«). Nun muss sie sich auf einmal um Hunderte von »Mädchen« kümmern, wie man damals sagt, obgleich viele von ihnen längst erwachsene Frauen sind. Für die angehenden Hostessen ist Krombholz strenge Lehrerin und gute Freundin in einer Person.
Besonders im Blick hat sie die Hostessen für die Siegerehrungen. »Wir haben erst mal 14 Tage eisern vor dem Spiegel trainiert«, erinne