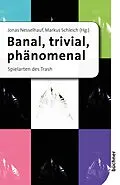Autorentext
Markus Schleich, M.A., geboren 1985. Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, Anglistik und Psychologie in Saarbru cken, Athen und Paris. Studienabschluss 2012 mit dem Magisterexamen. Seit 2012 Lehrbeauftragter und seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes. Sein Promotionsprojekt beschäftigt sich mit mythologischen Stoffen in der Popularmusik. Ausgewählte Publikationen: ">Even Jesus Wanted a Little More Time.< - Die Passion Christi bei Tom Waits, Nick Cave und Johnny Cash." In: Tim Lörke und Robert Walter-Jochum (Hg.): Religion und Literatur im 20. und 21. Jahrhundert. Motive, Sprechweisen, Medien. Göttingen 2015, S. 75-94; Fernsehserien. Geschichte, Theorie, Narration (mit Jonas Nesselhauf). Tübingen: Narr Francke Attempto 2016. Forschungsschwerpunkte: Intermedialität; Transmedialität; Popularmusikforschung; Populärkulturforschung; serielles Erzählen; TV Studies. Jonas Nesselhauf, BA MA, geboren 1987. Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft sowie Kunstgeschichte an der Universität des Saarlandes. Promotion 2016 an den Universitäten Vechta und Saarbrücken mit einer komparatistischen Arbeit zur Figur des Kriegsheimkehrers in der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts (Paderborn: Fink 2017). Derzeit Post Doc-Mitarbeiter an der Universität Vechta in den Fächern Kulturwissenschaft und Germanistik. Forschungsschwerpunkte: Literarische und künstlerische Darstellungen und Inszenierungen des menschlichen Körpers; Serialität und serielles Erzählen; Literatur und Ökonomie (besonders Wirtschaftskrisen).
Klappentext
Trash [træ ], der, Substantiv, aus dem Engl. Müll , Abfall , Schund ; bezeichnet in den Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften eine scheinbar minderwertige Ästhetik trivial-populärer Artefakte ( lowbrow), wobei die Grenzen zur absichtlichen Erzeugung von T. ( Meta-T.) teilweise fließend verlaufen und T. somit wiederum zu einem Schreibverfahren werden kann. Die Spielarten des T., des Meta-T. und der Verbindung von Kunst und Abfall umfassen verschiedenste Medien und Genres, darunter den T.film (bspw. in britischen 'Hammer'-Produktionen), Literatur und Lyrik (u.a. Friederike Kempner, Julie Schrader), Comic (Chris Ware etc.), Popmusik (etwa Blumfeld), Bildende Kunst (bspw. Kurt Schwitters), TV-Formate ( Reality-TV ), Computerspiele sowie als deren Performanz die Fanfiction oder 'Bad Taste Partys'.