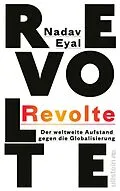Nadav Eyal reist ins kollabierte Griechenland, spricht mit deutschen Neonazis und Dürre-Opfern in Sri Lanka. Er problematisiert die sinkenden Geburtenraten bei wachsendem Wohlstand und erklärt am Beispiel seines Großvaters und zweier syrischer Jugendlicher den Wandel der Migration. Rund um den Erdball wüten dezentrale, führerlose Aufstände gegen die Idee des Fortschritts - ein breites und kompromissloses Aufbegehren gegen die Globalisierung. Eyals dramatische Gesamtschau macht klar: Wir werden kämpfen müssen, um unsere freiheitlichen Werte zu bewahren.
Nadav Eyal, *1979, ist einer der bekanntesten Journalisten Israels. Er ist der internationale Chef-Korrespondent von Channel 13 und hat den Sokolov Award (israelischer Pulitzer-Preis) erhalten. Er hat als Chevening-Stipendiat an der London School auf Economics Politik studiert sowie Jura an der Hebrew University. Er war außerdem Fellow beim Aspen China-Israel-Fellowship und ein Mitglied des Saban Forum der Brookings Institution in Washington.
Autorentext
Nadav Eyal, *1979, ist einer der bekanntesten Journalisten Israels. Er ist der internationale Chef-Korrespondent von Channel 13 und hat den Sokolov Award (israelischer Pulitzer-Preis) erhalten. Er hat als Chevening-Stipendiat an der London School auf Economics Politik studiert sowie Jura an der Hebrew University. Er war außerdem Fellow beim Aspen China-Israel-Fellowship und ein Mitglied des Saban Forum der Brookings Institution in Washington.
Zusammenfassung
Unsere Weltordnung zerfällt und der renommierte israelische Journalist Nadav Eyal hat einen Namen dafür: Revolte. Nationalismus, Migration, Klimawandel und politische Verwerfungen in einer scharfsinnigen Analyse erzählt Eyal die Geschichte des 21. Jahrhunderts. Seit Jahren reist er auf den Spuren dieser Entwicklung durch alle Kontinente. Sein Bestseller ist eine große Erzählung über eine bedrohliche neue Welt im Werden.Nadav Eyal reist ins kollabierte Griechenland, spricht mit deutschen Neonazis und Dürre-Opfern in Sri Lanka. Er problematisiert die sinkenden Geburtenraten bei wachsendem Wohlstand und erklärt am Beispiel seines Großvaters und zweier syrischer Jugendlicher den Wandel der Migration. Rund um den Erdball wüten dezentrale, führerlose Aufstände gegen die Idee des Fortschritts ein breites und kompromissloses Aufbegehren gegen die Globalisierung. Eyals dramatische Gesamtschau macht klar: Wir werden kämpfen müssen, um unsere freiheitlichen Werte zu bewahren.
Leseprobe
EINLEITUNG
Das Gebäude sah aus wie ein typischer Büroturm der Bauart, die man im Zentrum jeder florierenden Großstadt - von Manhattan über Shanghai bis London - findet. Die hohen Gäste wurden durch einen rückwärtigen Gang zu einem kleinen Wirtschaftsaufzug gelotst, der dem Ereignis unangemessen war, ihm aber etwas Geheimnisvolles verlieh. Unten angekommen, bot sich ein erfreulicher Anblick: ein »geheimer« privater Weinkeller, wie der Gastgeber erklärte. An einem Ende des Raums stand ein berühmter Chefkoch, der das Abendessen für die Gäste zubereitete. An den durchsichtigen Wänden lagerten dicht an dicht Weinflaschen, die eigens aus Weinkellereien in aller Welt eingeflogen worden waren. Die Anwesenden - Hightech-Unternehmer, ein ehemaliger Regierungschef, ein Ex-General, der sich aktuell gesellschaftlich engagierte, Generaldirektoren führender Firmen - waren sichtlich angetan, obwohl diese Leute sonst nicht so leicht zu begeistern sind. Der legendäre Name des großzügigen Gastgebers war allen
Geladenen bekannt, eigentlich sogar aller Welt.
Als wir uns zu Tisch setzten, sah ich in die Runde und zählte die Millionäre, diejenigen, die sich um ihre finanziellen Bedürfnisse und die ihrer Kinder und vermutlich auch ihrer Enkel keine Sorgen zu machen brauchten. Ich war gewiss als Einziger in einem Toyota Corolla mit lockerer Stoßstange vorgefahren.
Ich sollte ein wenig über die Weltlage reden, über die Globalisierung und die Revolte dagegen. Im sorgfältig ausgeleuchteten Halbdunkel des Weinkellers lauschten die Anwesenden aufmerksam meinen Ausführungen über die Bevölkerungskreise, die von der Wohlstandsgesellschaft der neuen Weltordnung ausgeschlossen waren, und über die riesenhaften Tech-Konzerne, die sich der praktischen Verantwortung für die Gebrechen der - von ihnen selbst geschaffenen - digitalen Welt entzogen. Ich sprach über die liberalen Werte und ihre Bedrohung durch das Wiedererstarken der Fortschrittsgegner und davon, dass junge Menschen immer seltener bereit seien, für die Demokratie zu kämpfen, und lieber über radikale Lösungen nachdächten. Die Daten zeigten, sagte ich, dass es der Menschheit gut ginge. Warum hätten dann so viele das Gefühl, dass alles schlecht sei?
Ich hätte die Reaktion voraussehen müssen. Die meisten Angehörigen des obersten Prozents der Weltbevölkerung halten die Krise von 2008 für eine vorüberziehende dunkle Wolke, Präsident Trumps Wahl für einen einmaligen historischen Unfall und den Fortschritt - in seiner aristokratischen Version - für unaufhaltsam. Der Gastgeber und ein oder zwei seiner Gäste begriffen die Analyse, auch wenn sie ihr nicht zustimmten. Die anderen wehrten ab. »Das ist übertriebener Pessimismus«, bemerkte jemand, und die Übrigen skandierten ihm leise nach: »Pes-si-mis-mus.« Die Gäste waren schnell mit der üblichen Auffassung zur Hand: Das sei alles nur eine »populistische Welle«, eine kurze Gegenreaktion, die ohne nennenswerten Schaden verebben werde. Das Gespräch verfiel zusehends in einen Anachronismus, in den typischen Diskurs der 1950erund 1960er-Jahrgänge, mit den gängigen Klischees von »man muss nur an den Erfolg glauben«, »wer nicht wagt, der nicht gewinnt«, »wir haben eine fantastische Jugend« und vor allem »man darf nicht schwarzsehen«. Die meisten wollten nicht zuhören, sondern mich - und damit meine ganze Generation - belehren, dass alles bestens ausgehen werde, wenn wir nur positiv dächten. Das Dessert setzte der höflichen Diskussion elegant ein Ende. Obwohl ich der Jüngste im Raum war, wusste ich, dass jede Diskussion entspannt verläuft, wenn die Zukunft der eigenen Kinder durch solide Wertpapiere gesichert ist.
Das Gespräch erinnerte mich an ein weit dramatischeres Ereignis, das ich zwei Jahre zuvor als Journalist erlebt hatte. Zu beiden Anlässen spielte Angst die Hauptrolle. Wenn die Steinreichen Angst bekommen, verfallen sie in lautstarken Optimismus. Die Mittelschicht wählt eine simplere Taktik: Sie schreit auf