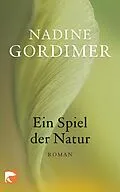Nadine Gordimer, geboren 1923 in dem Minenstädtchen Springs, Transvaal, gehört zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit. Jahrzehntelang schrieb sie gegen das Apartheidregime an und setzt sich bis heute mit dessen zerstörerischen Folgen für die schwarze und weiße Bevölkerung auseinander. 1991 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Sie starb am 13. Juli 2014 in Johannesburg, Südafrika.
Autorentext
Nadine Gordimer, geboren 1923 in dem Minenstädtchen Springs, Transvaal, gehört zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit. Jahrzehntelang schrieb sie gegen das Apartheidregime an und setzt sich bis heute mit dessen zerstörerischen Folgen für die schwarze und weiße Bevölkerung auseinander. 1991 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Sie starb am 13. Juli 2014 in Johannesburg, Südafrika.
Leseprobe
EINE LIMONADE FÜR MEIN SCHÄTZCHEN
IRGENDWO AUF DER Reise von Salisbury nach Johannesburg schüttelte das Mädchen den einen Namen ab und tauchte unter dem anderen wieder auf. Während sie Gummi kaute und den auf- und abschwebenden Felsgürtel an sich vorbeigleiten ließ, die Zwischenstationen, wo schwarze Kinder winkten, die äsende Springbockherde, die vor dem nahenden Zug in schreckhaft weiten Fluchten dem Horizont zustrebte, warf sie die »Kim« mitsamt ihrem Schulstrohhut ins Gepäcknetz und entschied sich für Hillela. Die braunen Strümpfe rutschten ihr an den Beinen herunter und prickelten angenehm an den feinen Härchen. Sie kramte Sandalen und ein Kleid aus ihrem Koffer und zog sich um, ohne sich um die anderen Frauen im Abteil zu kümmern. Sie fuhr, wie jedesmal, zu einer ihrer Tanten mütterlicherseits, bei der ihr alle denkbaren Vorteile geboten wurden, und kam aus einem rhodesischen Mädcheninternat. Wenn man sie fragte, warum sie nicht in Südafrika zur Schule ginge, antwortete sie stets, ihr Vater sei in Salisbury aufgewachsen, und deshalb schicke man sie dorthin. Sie war ja nicht das einzige Kind, dessen Eltern geschieden oder getrennt oder sonstwas waren. Aber sie war die einzige Hillela unter lauter Susans und Clares und Fionas. Was war das eigentlich für ein Name? Wußte sie selber nicht, konnte sie nicht erklären. Was sie ohne Zögern erklärte, war, daß man sie jedenfalls ewig bei ihrem zweiten Namen, Kim, gerufen habe. Im Lauf der Jahre nannten sogar ihre Lehrer sie niemals anders als Kim. Keiner fand was dabei, wenn sie sonntags mit all den anderen Kims, Susans, Clares und Fionas in die anglikanische Kirche ging, obwohl in ihren Schulpapieren unter »Konfession« das Wort »jüdisch« eingetragen war.
Tante Olga holte sie am Bahnhof ab. Später geschah dies am Flughafen; vermutlich hatte Olga ihrem Vater gesagt, es sei lächerlich, dem Kind jedesmal eine zweitägige heiße und ermüdende Eisenbahnfahrt zuzumuten. Vielleicht bezahlte Olga sogar das Flugticket; sie war großzügig. Oft sagte sie, nie zu Hillela direkt, aber in Gesellschaft, indem sie Hillelas Ponyfransen zauste oder den Arm um sie legte: »Oh - das ist das Töchterchen, das ich nicht gekriegt habe.«
Ihr Zimmer stand bereit, mit einer Rose in den Sommerferien und Freesien oder Jonquillen im Winter, die wie Olgas Umarmung dufteten, mit Handtüchern, dick wie Schaffell, und einer Schale, die von ihren Lieblings-Lakritzbonbons überquoll. Einige der Sachen gehörten ihr: Ferienkleider, die sie jedesmal daließ, wenn sie ins Internat zurückmußte, Bücher, Kinkerlitzchen, die sie nicht mehr mochte. Ihre Abwesenheit dauerte länger als ihre Gegenwart; daher fanden sich immer Zeichen, daß der Raum inzwischen anderweitig benutzt worden war. Olga verwahrte Sommer- oder Winterkleider in den Schränken; Logiergäste, die in dem hübschen Bett geschlafen hatten, vergaßen dies und jenes; Bücher, die Olga nicht unten zur Schau stellen, aber auch nicht wegwerfen wollte, bildeten eine Ramsch-Auswahl auf dem Regal. Einmal stand in den Ferien unversehens ein Photo von Hillelas Mutter in einem viktorianischen Plüsch- und Silberrahmen neben der Bonbonschale. Das Gesicht war auf eine Art »gefaßt«, wie das Mädchen noch keines gesehen hatte: das Haar wie eine Pergamentrolle von beiden Schläfen zurückgelegt und über die Stirn gezogen; die anmutig geformten Lippen glänzten schwarz wie flüssiger Teer, ihre reine Form wurde nicht einmal durch ein Lächeln verzerrt. Der einzige Zug, der irgendeine erkennbare Lebensechtheit aufwies, lag um die Augen; es waren die Augen einer Frau, die sich selbst im Spiegel sieht. Das Bild endete kurz unter den Schultern, die in einem Jackett mit breiten Armpolstern und Revers steckten.
»War sie in der Armee?«
Olga hatte das Mädchen beobachtet, wie sie immer Leute beobachtete, die sie, nach sorgfältiger Prüfung auf Harmonie und gemeinsame Interessen, für ihre Dinnerpartie