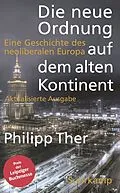Als im November 1989 die Mauer fiel, begann ein Großexperiment kontinentalen Ausmaßes: Die ehemaligen Staaten
des »Ostblocks« wurden binnen kurzer Zeit auf eine neoliberale Ordnung getrimmt und dem Regime der Privatisierung
und Liberalisierung unterworfen. Diese Transformation brachte Gewinner und Verlierer hervor: Russland glitt in ein wirtschaftliches Chaos ab, auf dem Präsident Putin sein autoritäres Regime begründete, Länder wie Polen, Tschechien oder Ungarn erholten sich und sind heute Mitglieder der EU. Während Warschau und andere Hauptstädte sich zu Boomtowns entwickelten, verarmten ländliche Regionen.
In seinem »elektrisierenden Buch« (Jens Bisky, SZ) legt Philipp Ther eine umfassende zeithistorische Analyse der neuen Ordnung auf dem alten Kontinent vor - und zwar erstmals in gesamteuropäischer Perspektive. Er räumt mit einigen Mythen rund um »1989« auf und präsentiert eine erste Bilanz der neoliberalen Ordnung.
Philipp Ther, geboren 1967, ist ein deutscher Sozial- und Kulturhistoriker. Nach Stationen u. a. an der FU Berlin, der Viadrina in Frankfurt/Oder, an der Harvard University und am European University Institute in Florenz ist er seit 2010 Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Seine Bücher Die dunkle Seite der Nationalstaaten. »Ethnische Säuberungen« im modernen Europa (2011), Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa (2014) und Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa (2017) wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent u. a. mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse 2015. 2019 erhielt Philipp Ther den Wittgenstein-Preis, den höchstdotierten Wissenschaftspreis Österreichs.
Autorentext
Philipp Ther, geboren 1967, ist ein deutscher Sozial- und Kulturhistoriker. Nach Stationen u. a. an der FU Berlin, der Viadrina in Frankfurt/Oder, an der Harvard University und am European University Institute in Florenz ist er seit 2010 Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Seine Bücher Die dunkle Seite der Nationalstaaten. »Ethnische Säuberungen« im modernen Europa (2011), Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa (2014) und Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa (2017) wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent u. a. mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse 2015. 2019 erhielt Philipp Ther den Wittgenstein-Preis, den höchstdotierten Wissenschaftspreis Österreichs.
Leseprobe
412. Krisen und Reformdebatten der achtziger Jahre
Der Niedergang des Staatssozialismus
Der Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft und des Ostblocks kam für die meisten westlichen Spezialisten und die internationale Politik völlig überraschend. Das lag unter anderem an der Außenwahrnehmung der staatssozialistischen Länder als totalitäre Systeme. In den USA war diese Sichtweise besonders verbreitet. Gemäß dem Ansatz der Totalitarismusforschung besaßen die Kommunisten unbeschränkte Macht, die Gesellschaften waren »atomisiert« und somit passiv. Dieses statische Bild des Ostblocks hatte mit den gesellschaftlichen Entwicklungen im späten Staatssozialismus wenig gemein. Zur westlichen Sichtweise gehörte es außerdem, die sowjetische Herrschaftssphäre als Einheit zu betrachten - so wie in den westdeutschen Schulatlanten, in denen sämtliche Staaten hinter dem Eisernen Vorhang in ein böses Rot getaucht und die westlichen Staaten in einem lichten Blau dargestellt wurden. Nur wenige Experten wie der deutsche Politologe Klaus Segbers oder der schwedische Ökonom Anders Åslund erkannten vor 1989 das Ausmaß der gesellschaftlichen Dynamik und der wirtschaftlichen Krise in der Sowjetunion.1
Der Niedergang des Staatssozialismus begann weit früher, in den späten sechziger Jahren. Die Niederschlagung des Prager Frühlings und damit des »Sozialismus mit einem menschlichen Antlitz« zerstörte die Hoffnungen auf eine Reformierbarkeit des Systems. Polen und Ungarn öffneten sich in den siebziger Jahren wirtschaftlich, doch der Import westlicher Technologie (zum Beispiel bei »Polski Fiat« oder in der Werftindustrie an der Ostsee) bewirkte keine gesteigerte Effizienz der Planwirtschaft, es blieben vor allem unbezahlbare Auslandsschulden. Die Sowjetunion wirkte nach außen mächtig und stagnierte ökonomisch. Sämtliche Ostblockstaaten verpassten die »digitale Revolution «, in der das Wirtschaften auf neuen 42Technologien, Produktivitätsgewinnen und internationalem Warenaustausch beruht.
Der wachsende wirtschaftliche Abstand zwischen Ost und West unterminierte die Legitimität der regierenden Kommunisten, die in der DDR einst mit dem Motto »Überholen, ohne einzuholen« angetreten waren.2 Die Machthaber versuchten, die Bevölkerung durch eine bessere Versorgung mit Konsumgütern zufriedenzustellen, aber auch in diesem Bereich waren die Resultate mager. Etliche Konsumprodukte gab es selten oder gar nicht, wenn dann waren sie nur gegen Devisen in speziellen Geschäften wie den Intershop-, Tuzex- und Pewex-Läden erhältlich - auch daher die eingangs geschilderte Bedeutung des Schwarztauschens und des Devisenschmuggels (für den es eine »zollsichere« Lösung gab: Drei gefaltete Hundertmark-Scheine waren so dick wie ein Bahlsen-Butterkeks. In die Kekspackung kamen sie, indem man den Klebefalz mit Wasserdampf öffnete und anschließend wieder verschloss). Wegen des Machtmonopols der Partei machte die Bevölkerung die Kommunisten für die Mangelwirtschaft verantwortlich.
Wie instabil die Lage war, zeigte sich 1979/80 in Polen. Dort versuchte die Regierung, das staatliche Budgetdefizit durch Preiserhöhungen für Konsumgüter und sogar für Grundnahrungsmittel zu reduzieren. Die massenhaften Proteste und andere Missstände führten zur Gründung der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc. Damit war erstmals in einem kommunistisch regierten Land eine Massenbewegung jenseits der Partei und der offiziellen Organisationen entstanden. Ende der achtziger Jahre konnten auch die reicheren Ostblockländer den inoffiziellen contrat social, eine verbesserte Konsumgüterversorgung im Austausch für politisches Stillhalten, nicht mehr erfüllen.3 Michail Gorbatschow reagierte auf die Dauerkrise mit Glasnost und Perestroika, scheiterte aber ebenso wie die ungarischen und polnischen Reform