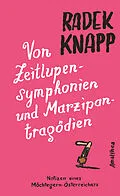Radek Knapp, geboren in Warschau, ist freier Schriftsteller. Seine literarischen Bestseller erscheinen in zahlreichen Auflagen und Sprachen, darunter der Publikumserfolg 'Herrn Kukas Empfehlungen', 'Franio', 'Reise nach Kalino', 'Der Mann, der Luft zum Frühstück aß' oder 'Gebrauchsanweisung für Polen'. Ausgezeichnet mit dem 'aspekte'-Literaturpreis sowie dem Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. Er lebt in Wien.
Autorentext
Radek Knapp, geboren in Warschau, ist freier Schriftsteller. Seine literarischen Bestseller erscheinen in zahlreichen Auflagen und Sprachen, darunter der Publikumserfolg "Herrn Kukas Empfehlungen", "Franio", "Reise nach Kalino", "Der Mann, der Luft zum Frühstück aß" oder "Gebrauchsanweisung für Polen". Ausgezeichnet mit dem "aspekte"-Literaturpreis sowie dem Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. Er lebt in Wien.
Leseprobe
Deutsch für Sture
Bevor mein Großvater mir Österreich aufgeschwatzt hat, wusste ich über dieses Land nur drei Dinge. Erstens, dass dort einmal ein gewisser Kaiser Franz Joseph so lange regiert hat, bis ihm derart exorbitante Bartkoteletten gewachsen waren, dass man sein Gesicht nicht mehr sah. Zweitens sollte dort ein Mann namens Niki Lauda schwere Millionen verdienen, weil er einmal pro Woche möglichst schnell im Kreis fuhr. Und drittens, dass man dort Deutsch sprach. Letzteres war an sich keine schlechte Nachricht für jemanden, der mit polnischen Kriegsfilmen aufgewachsen war, wo man immer wieder einen Satz auf Deutsch einstreute. Leider waren es hauptsächlich Sätze militärischer Natur wie »Heute erobern wir Stalingrad« oder »Nur über die Leiche unseres Generals«.
Also tauchte ich vor der Abfahrt sicherheitshalber noch in den großen Ozean deutscher Zivilausdrücke ein, um vor Ort nicht wie ein Militär oder ein Dummkopf dazustehen. Ich besorgte mir dazu das in Polen seinerzeit populäre DDR-Lehrbuch Deutsch für Sture.
Interessanterweise hatte mein Exemplar einen Druckfehler, wodurch man die Seite 1 mit der Seite 48 vertauscht hatte. So lernte ich nicht als Erstes »Ich heiße Franz und komme aus Rostock« oder »Ich bin Heike und esse gerne Erdbeereis«, sondern den rätselhaften Ausdruck »Ein Wasserrohrbruch kann sogar zwei Menschenleben kosten«, gefolgt von »Einem deutschen Klempner ist nichts zu schwer«.
Nicht nötig zu sagen, dass mir diese beiden Sätze später viel nützlicher waren als die Information über Heikes Eisvorlieben. Aber egal, welche Seite ich in Deutsch für Sture auch aufschlug, eines blieb immer gleich: Deutsch verschwendete überhaupt keine Zeit. Was immer man in dieser Sprache sagte, sie gab einem nicht nur das Gefühl, etwas gespart zu haben, sondern erinnerte einen auch daran: »Das Leben ist kurz, also fasse dich lieber kurz.« Ganz anders als das Polnische, wo bei jeder Bemerkung automatisch mitschwang: »Was ich jetzt sage, kann ich auch morgen sagen. Müssen wir eigentlich überhaupt darüber reden?«
Diese geradezu sadistische Sparsamkeit verzauberte mich. Hörte man einem Slawen eine halbe Stunde zu, musste man das Gehörte nachher wie einen Schwamm in der Hand zusammendrücken, um die Essenz herauszupressen. Drückte man das Deutsche zusammen, war es so, als würde man einen Stein zusammenpressen. Ein deutscher Satz war ein Satz, dem man nichts mehr hinzuzufügen brauchte.
Nachdem ich die erfrischende Sparsamkeit der deutschen Sprache verinnerlicht hatte, konnte ich es kaum erwarten, mein Wissen auszuprobieren. Sobald ich aber österreichischen Boden berührte, bereitete mir der kleine längliche Kaffeefleck schon die erste Überraschung: Nämlich, dass man hier gar nicht Deutsch sprach.
Ich weiß noch, wie ich, kurz nachdem ich aus dem Zug gestiegen war, in eine Bahnhofskneipe ging und schon von der Schwelle den merkwürdigen Satz hörte: »Geh bodn (gehe baden)!« Es war keine Aufforderung, das nächstgelegene Schwimmbad aufzusuchen, sondern die Kneipe recht flott wieder zu verlassen. Abgesehen davon, dass es sich um eine originelle Begrüßung handelte, kam es mir vor, als hätte mir eine fremde Macht einen üblen Streich gespielt. Nicht nur mein ganzer Deutschunterricht war umsonst, das Wienerische fiel in eine seltsame Undeutlichkeit zurück, die mir verdächtig slawisch vorkam. Wenig später bestätigte sich ein weiterer Verdacht. Der Wiener hatte den Wiener Dialekt eindeutig nur deshalb erfunden, um sofort jeden Nichtwiener zu entlarven. Er ließ sich unmöglich nachmachen und zu alldem herrschte hier eine Dialektvielfalt wie im Kongobecken.
Wie alle Verzweifelten, die vor einer unlösbaren Aufgabe stehen, schlug ich zuerst den Weg des geringsten Widerstandes ein. Im Laufe der nächsten Wochen konzentrierte ich mich nur auf Worte, die mir irg