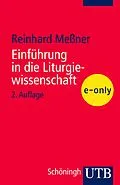Nach einer knappen Besinnung auf die Aufgaben des Faches "Liturgiewissenschaft" folgen eine Hinführung zur grundsätzlichen Bedeutung des Gottesdienstes im christlichen Leben, Erläuterungen zu den Gestaltungselementen der christlichen Liturgie und eine Skizze wichtiger geschichtlicher Stationen. Der Hauptteil des Buches befasst sich mit den verschiedenen gottesdienstlichen Feiern, wobei der Schwerpunkt auf der Eucharistie, den Feiern der Initiation (Taufe und Firmung) und der Tagzeitenliturgie (Stundengebet) liegt. Damit liegt erstmals eine liturgiegeschichtliche Darstellung vor, die die historische und die systematisch-theologische Perspektive verbindet.
Autorentext
Prof. Dr. Reinhard Messner lehrt an der Uni Innsbruck.
Inhalt
Vorwort 17 EINLEITUNG: WAS IST LITURGIEWISSENSCHAFT? 19 1. Der Ursprung der Liturgiewissenschaft 19 2. Die drei Dimensionen der Liturgiewissenschaft 24 2.1 Historische Liturgiewissenschaft 25 2.2 Systematische Liturgiewissenschaft 25 2.3 Kritische Liturgiewissenschaft 26 3. Das eine Thema der Liturgiewissenschaft: der Glaube 27 4. Der Zugang der Liturgiewissenschaft zu dem einen Uberlieferungsgeschehen: die vielen liturgischen Traditionen 30 5. Das Vorgehen der Liturgiewissenschaft: der Kommentar 32 I. KAPITEL: EINIGE HINWEISE ZU LITURGISCHEN QUELLEN UND ZU GRUNDLEGENDER LITERATUR 35 1. Quellen 35 1.1 Eine grundlegende Unterscheidung 35 1.2 Liturgische Quellen aus der Zeit der alten Kirche 36 1.2.1 Kirchenordnungen 36 1.2.2 Die Peregrinatio Egeriae und andere Jerusalemer Quellen 39 1.2.3 Mystagogische Katechesen 40 1.2.4 Apokryphe Apostelakten 41 1.2.5 Monchsregeln 42 1.2.6 Schriften der Kirchenvater 43 1.3 Liturgische Quellen aus dem westlichen Mittelalter 44 1.3.1 Gebetstextsammlungen 45 1.3.1.1 Libelli missarum 45 1.3.1.2 Sakramentare 45 1.3.1.3 Das Kollektar 47 1.3.2 Liturgische Bucher fur die Schriftlesungen 47 1.3.3 Liturgische Bucher fur die Gesange 48 1.3.4 Die Ordines Romani 48 1.3.5 Die Libri Ordinarii 49 1.3.6 Liturgische Bucher fur einzelne Gottesdienste 49 1.3.6.1 Plenarmissale und Brevier 49 1.3.6.2 Pontifikale und Rituale 50 1.3.7 Die Capitula episcoporum 51 1.3.8 Liturgieerklarungen 51 1.4 Die gedruckten liturgischen Bucher der Neuzeit 53 1.5 Die derzeit geltenden liturgischen Bucher im romischen Ritus 53 2. Handbucher und andere Hilfsmittel zum Studium der Liturgiewissenschaft 55 2.1 Bibliographie 55 2.2 Handbucher und Lehrbucher 55 2.3 Lexika und Nachschlagewerke 57 2.4 Liturgiegeschichte 57 2.5 Dokumentensammlungen 57 2.6 Zeitschriften 58 II. KAPITEL: DIE CHRISTLICHE INITIATION 59 0. Hinfuhrung 60 0.1 Zum Begriff Initiation 60 0.2 Zur Bedeutung der Taufe und zur Problematik heutiger Taufpraxis 62 1. Zum Ursprung der christlichen Taufe 64 1.1 Die Johannestaufe: die Wurzel der christlichen Taufe 64 1.2 Die Taufe Jesu: das Urbild der christlichen Taufe 68 2. Die Taufe im Urchristentum: Lehre und Praxis 70 2.1 Taufe als eschatologische Versiegelung 71 2.2 Taufe als Eintritt in das eschatologische Christusereignis: christologischer Bezug 72 2.2.1 Taufe auf den Namen Jesu (Christi) 72 2.2.2 Taufe als Ubereignung an Christus Taufe, Glaube und Bekenntnis 73 2.2.3 Taufe als Teilhabe an Tod und Auferstehung Christi 78 2.3 Taufe als Eintritt in die eschatologische Gemeinde: ekklesiologischer Bezug 82 2.4 Taufe als Empfang der eschatologischen Gabe: pneumatologischer Bezug 83 3. Ausgewahlte Stationen aus der Geschichte des Taufgottesdienstes 85 3.1 Zwei spatantike Traditionen 85 3.1.1 Die syrische Tradition 86 3.1.2 Die mediterrane Tradition 92 3.1.2.1 Der Katechumenat 93 3.1.2.2 Der Taufgottesdienst 96 3.2 Zur Geschichte des romischen Taufritus 103 3.2.1 Der romische Taufritus in Spatantike und Fruhmittelalter 103 3.2.1.1 Die Katechumenatsriten 104 3.2.1.2 Der Taufgottesdienst 107 3.2.2 Der Kindertaufritus im Rituale Romanum von 1614 109 3.3 Die Taufe im mittelalterlichen und neuzeitlichen Kontext 113 3.3.1 Von der durch den Bischof geleiteten Stadtgemeinde ins stadtlose Fruhmittelalter: der Verlust der Gemeinde als erfahrbarer Realitat 113 3.3.2 Die Taufe ist praktisch ausschlieslich Sauglingstaufe 114 3.3.3 Die Taufe wird zur Initiation in die Gesellschaft 114 3.3.4 Der Zusammenhang von Sakramentalisierung und Evangelisierung wird problematisch 115 3.3.5 Die Dekomposition der Initiationssakramente 116 3.3.6 Das problematische Verhaltnis von Symbol und Wirklichkeit und der liturgische Minimalismus 116 4. Die derzeitige Ordnung der christlichen Initiation in der romisch-katholischen Kirche 118 4.1 Erneuerungsimpulse am 2. Vatikanischen Konzil 118 4.2 Die Feier der Kindertaufe 118 4.2.1 Die Eroffnung am Eingang der Kirche 120 4.2.2 Der Wortgottesdienst 120 4.2.3 Die ehemaligen Katechumenatsriten 121 4.2.4 Die Taufhandlung am Taufbrunnen 122 4.2.4.1 Das Taufwasserweihegebet 122 4.2.4.2 Abrenuntiation und Glaubensbekenntnis 124 4.2.4.3 Der eigentliche Taufakt 125 4.2.4.4 Die Scheitelsalbung mit Chrisma 125 4.2.5 Postbaptismale Riten 127 4.2.5.1 Die Bekleidung mit dem Taufkleid 128 4.2.5.2 Die Uberreichung der Taufkerze 129 4.2.5.3 Der Effata-Ritus 130 4.2.6 Der Abschlus am Altar 130 4.3 Die Ordnung der Erwachseneninitiation 130 5. Die Firmung 136 5.1 Die Verselbstandigung der Firmung gegenuber der Taufe 136 5.2 Zu Ritus und Praxis der Firmung 137 5.3 Zur Firmtheologie 138 5.4 Die Reform der Firmung nach dem 2. Vatikanischen Konzil 140 6. Perspektiven zur Taufpastoral und Taufpraxis der Zukunft 142 6.1 Zwei Initiationsmodelle zwei Kirchenbilder 143 6.2 Die heutige Situation: langsamer Ubergang von der Volkskirche zu einer Dienstleistungsgesellschaft? 145 6.3 Zur Taufpraxis in der heutigen Situation des Ubergangs 146 6.4 Zum gegenseitigen Verhaltnis der drei Initiationssakramente 148 III. KAPITEL: DIE EUCHARISTIE 150 0. Hinfuhrung: Die eucharistische Ekklesiologie als theologische Grundperspektive 151 1. Das letzte Mahl Jesu (Abschiedsmahl) 153 1.1 Die Quellen 153 1.2 Die Gestalt: ein judisches (Abend-)Essen, bei dem Wein getrunken wird 154 1.3 Die besonderen Motive des letzten Mahles Jesu 156 1.3.1 Das Mahl als Antizipation der eschatologischen communio im Reich Gottes 156 1.3.2 Die Proklamation des Heilstodes Jesu als Weg in die eschatologische communio 157 2. Das urchristliche Herrenmahl als Christusanamnese 160 2.1 Nachosterliche Transformation der Mahlgemeinschaft mit Jesus 160 2.2 Was ist Anamnese? 161 2.2.1 Kulturanthropologisch: die grundlegende Funktion des (menschlichen) Gedachtnisses 161 2.2.2 Biblisch-theologisch: die judisch-christliche Anamnese 162 2.2.3 Eucharistische Anamnese als Christusanamnese 164 2.2.4 Die dreifache Weise des Vollzugs der eucharistischen Christusanamnese 165 2.2.5 Christusanamnese als pneumatischer Vorgang 166 2.2.6 Christusanamnese als Weg zur Anbetung Gottes 166 2.3 Die Gestalt der eucharistischen Christusanamnese im urchristlichen Herrenmahl 166 3. Vom Herrenmahl zur Messe 170 4. Die Messe im romischen Ritus: Grundstrukturen und ihre Bedeutung 173 4.1 Die Eroffnungsriten: Kirche als Sammlung der Menschheit im Reich Gottes 173 4.1.1 Schematische Ubersicht 173 4.1.2 Das geistliche Grundgeschehen 174 4.1.3 Zeit und Anlas der Versammlung zur Eucharistie 176 4.1.4 Die Grundgestalt 179 4.1.5 Sekundare Elemente 183 4.2 Wortgottesdienst: Kirche unter der schopferischen Macht des Wortes Gottes 183 4.2.1 Schematische Ubersicht (Wortgottesdienst in der Sonntagsmesse) 183 4.2.2 Das geistliche Grundgeschehen 184 4.2.3 Was ist Verkundigung? 185 4.2.3.1 Verkundigung als Wandlungsgeschehen 185 4.2.3.2 Verkundigung als Offenbarungsgeschehen 187 4.2.3.3 Verkundigung als anamnetisches Geschehen 189 4.2.3.4 Verkundigung als Geistgeschehen 190 4.2.4 Die gottesdienstliche Realisierung des Offenbarungsereignisses im Wortgottesdienst der Messe 191 4.2.5 Der Wortgottesdienst der Messe als anamnetischer Wortgottesdienst 193 4.2.6 Das Glaubensbekenntnis 195 4.2.7 Das Allgemeine Gebet 195 4.2.7.1 Bedeutung 195 4.2.7.2 Inhalt 195 4.2.7.3 Gestalt und Fehlformen 19…
Autorentext
Prof. Dr. Reinhard Messner lehrt an der Uni Innsbruck.
Inhalt
Vorwort 17 EINLEITUNG: WAS IST LITURGIEWISSENSCHAFT? 19 1. Der Ursprung der Liturgiewissenschaft 19 2. Die drei Dimensionen der Liturgiewissenschaft 24 2.1 Historische Liturgiewissenschaft 25 2.2 Systematische Liturgiewissenschaft 25 2.3 Kritische Liturgiewissenschaft 26 3. Das eine Thema der Liturgiewissenschaft: der Glaube 27 4. Der Zugang der Liturgiewissenschaft zu dem einen Uberlieferungsgeschehen: die vielen liturgischen Traditionen 30 5. Das Vorgehen der Liturgiewissenschaft: der Kommentar 32 I. KAPITEL: EINIGE HINWEISE ZU LITURGISCHEN QUELLEN UND ZU GRUNDLEGENDER LITERATUR 35 1. Quellen 35 1.1 Eine grundlegende Unterscheidung 35 1.2 Liturgische Quellen aus der Zeit der alten Kirche 36 1.2.1 Kirchenordnungen 36 1.2.2 Die Peregrinatio Egeriae und andere Jerusalemer Quellen 39 1.2.3 Mystagogische Katechesen 40 1.2.4 Apokryphe Apostelakten 41 1.2.5 Monchsregeln 42 1.2.6 Schriften der Kirchenvater 43 1.3 Liturgische Quellen aus dem westlichen Mittelalter 44 1.3.1 Gebetstextsammlungen 45 1.3.1.1 Libelli missarum 45 1.3.1.2 Sakramentare 45 1.3.1.3 Das Kollektar 47 1.3.2 Liturgische Bucher fur die Schriftlesungen 47 1.3.3 Liturgische Bucher fur die Gesange 48 1.3.4 Die Ordines Romani 48 1.3.5 Die Libri Ordinarii 49 1.3.6 Liturgische Bucher fur einzelne Gottesdienste 49 1.3.6.1 Plenarmissale und Brevier 49 1.3.6.2 Pontifikale und Rituale 50 1.3.7 Die Capitula episcoporum 51 1.3.8 Liturgieerklarungen 51 1.4 Die gedruckten liturgischen Bucher der Neuzeit 53 1.5 Die derzeit geltenden liturgischen Bucher im romischen Ritus 53 2. Handbucher und andere Hilfsmittel zum Studium der Liturgiewissenschaft 55 2.1 Bibliographie 55 2.2 Handbucher und Lehrbucher 55 2.3 Lexika und Nachschlagewerke 57 2.4 Liturgiegeschichte 57 2.5 Dokumentensammlungen 57 2.6 Zeitschriften 58 II. KAPITEL: DIE CHRISTLICHE INITIATION 59 0. Hinfuhrung 60 0.1 Zum Begriff Initiation 60 0.2 Zur Bedeutung der Taufe und zur Problematik heutiger Taufpraxis 62 1. Zum Ursprung der christlichen Taufe 64 1.1 Die Johannestaufe: die Wurzel der christlichen Taufe 64 1.2 Die Taufe Jesu: das Urbild der christlichen Taufe 68 2. Die Taufe im Urchristentum: Lehre und Praxis 70 2.1 Taufe als eschatologische Versiegelung 71 2.2 Taufe als Eintritt in das eschatologische Christusereignis: christologischer Bezug 72 2.2.1 Taufe auf den Namen Jesu (Christi) 72 2.2.2 Taufe als Ubereignung an Christus Taufe, Glaube und Bekenntnis 73 2.2.3 Taufe als Teilhabe an Tod und Auferstehung Christi 78 2.3 Taufe als Eintritt in die eschatologische Gemeinde: ekklesiologischer Bezug 82 2.4 Taufe als Empfang der eschatologischen Gabe: pneumatologischer Bezug 83 3. Ausgewahlte Stationen aus der Geschichte des Taufgottesdienstes 85 3.1 Zwei spatantike Traditionen 85 3.1.1 Die syrische Tradition 86 3.1.2 Die mediterrane Tradition 92 3.1.2.1 Der Katechumenat 93 3.1.2.2 Der Taufgottesdienst 96 3.2 Zur Geschichte des romischen Taufritus 103 3.2.1 Der romische Taufritus in Spatantike und Fruhmittelalter 103 3.2.1.1 Die Katechumenatsriten 104 3.2.1.2 Der Taufgottesdienst 107 3.2.2 Der Kindertaufritus im Rituale Romanum von 1614 109 3.3 Die Taufe im mittelalterlichen und neuzeitlichen Kontext 113 3.3.1 Von der durch den Bischof geleiteten Stadtgemeinde ins stadtlose Fruhmittelalter: der Verlust der Gemeinde als erfahrbarer Realitat 113 3.3.2 Die Taufe ist praktisch ausschlieslich Sauglingstaufe 114 3.3.3 Die Taufe wird zur Initiation in die Gesellschaft 114 3.3.4 Der Zusammenhang von Sakramentalisierung und Evangelisierung wird problematisch 115 3.3.5 Die Dekomposition der Initiationssakramente 116 3.3.6 Das problematische Verhaltnis von Symbol und Wirklichkeit und der liturgische Minimalismus 116 4. Die derzeitige Ordnung der christlichen Initiation in der romisch-katholischen Kirche 118 4.1 Erneuerungsimpulse am 2. Vatikanischen Konzil 118 4.2 Die Feier der Kindertaufe 118 4.2.1 Die Eroffnung am Eingang der Kirche 120 4.2.2 Der Wortgottesdienst 120 4.2.3 Die ehemaligen Katechumenatsriten 121 4.2.4 Die Taufhandlung am Taufbrunnen 122 4.2.4.1 Das Taufwasserweihegebet 122 4.2.4.2 Abrenuntiation und Glaubensbekenntnis 124 4.2.4.3 Der eigentliche Taufakt 125 4.2.4.4 Die Scheitelsalbung mit Chrisma 125 4.2.5 Postbaptismale Riten 127 4.2.5.1 Die Bekleidung mit dem Taufkleid 128 4.2.5.2 Die Uberreichung der Taufkerze 129 4.2.5.3 Der Effata-Ritus 130 4.2.6 Der Abschlus am Altar 130 4.3 Die Ordnung der Erwachseneninitiation 130 5. Die Firmung 136 5.1 Die Verselbstandigung der Firmung gegenuber der Taufe 136 5.2 Zu Ritus und Praxis der Firmung 137 5.3 Zur Firmtheologie 138 5.4 Die Reform der Firmung nach dem 2. Vatikanischen Konzil 140 6. Perspektiven zur Taufpastoral und Taufpraxis der Zukunft 142 6.1 Zwei Initiationsmodelle zwei Kirchenbilder 143 6.2 Die heutige Situation: langsamer Ubergang von der Volkskirche zu einer Dienstleistungsgesellschaft? 145 6.3 Zur Taufpraxis in der heutigen Situation des Ubergangs 146 6.4 Zum gegenseitigen Verhaltnis der drei Initiationssakramente 148 III. KAPITEL: DIE EUCHARISTIE 150 0. Hinfuhrung: Die eucharistische Ekklesiologie als theologische Grundperspektive 151 1. Das letzte Mahl Jesu (Abschiedsmahl) 153 1.1 Die Quellen 153 1.2 Die Gestalt: ein judisches (Abend-)Essen, bei dem Wein getrunken wird 154 1.3 Die besonderen Motive des letzten Mahles Jesu 156 1.3.1 Das Mahl als Antizipation der eschatologischen communio im Reich Gottes 156 1.3.2 Die Proklamation des Heilstodes Jesu als Weg in die eschatologische communio 157 2. Das urchristliche Herrenmahl als Christusanamnese 160 2.1 Nachosterliche Transformation der Mahlgemeinschaft mit Jesus 160 2.2 Was ist Anamnese? 161 2.2.1 Kulturanthropologisch: die grundlegende Funktion des (menschlichen) Gedachtnisses 161 2.2.2 Biblisch-theologisch: die judisch-christliche Anamnese 162 2.2.3 Eucharistische Anamnese als Christusanamnese 164 2.2.4 Die dreifache Weise des Vollzugs der eucharistischen Christusanamnese 165 2.2.5 Christusanamnese als pneumatischer Vorgang 166 2.2.6 Christusanamnese als Weg zur Anbetung Gottes 166 2.3 Die Gestalt der eucharistischen Christusanamnese im urchristlichen Herrenmahl 166 3. Vom Herrenmahl zur Messe 170 4. Die Messe im romischen Ritus: Grundstrukturen und ihre Bedeutung 173 4.1 Die Eroffnungsriten: Kirche als Sammlung der Menschheit im Reich Gottes 173 4.1.1 Schematische Ubersicht 173 4.1.2 Das geistliche Grundgeschehen 174 4.1.3 Zeit und Anlas der Versammlung zur Eucharistie 176 4.1.4 Die Grundgestalt 179 4.1.5 Sekundare Elemente 183 4.2 Wortgottesdienst: Kirche unter der schopferischen Macht des Wortes Gottes 183 4.2.1 Schematische Ubersicht (Wortgottesdienst in der Sonntagsmesse) 183 4.2.2 Das geistliche Grundgeschehen 184 4.2.3 Was ist Verkundigung? 185 4.2.3.1 Verkundigung als Wandlungsgeschehen 185 4.2.3.2 Verkundigung als Offenbarungsgeschehen 187 4.2.3.3 Verkundigung als anamnetisches Geschehen 189 4.2.3.4 Verkundigung als Geistgeschehen 190 4.2.4 Die gottesdienstliche Realisierung des Offenbarungsereignisses im Wortgottesdienst der Messe 191 4.2.5 Der Wortgottesdienst der Messe als anamnetischer Wortgottesdienst 193 4.2.6 Das Glaubensbekenntnis 195 4.2.7 Das Allgemeine Gebet 195 4.2.7.1 Bedeutung 195 4.2.7.2 Inhalt 195 4.2.7.3 Gestalt und Fehlformen 19…
Titel
Einführung in die Liturgiewissenschaft
Autor
EAN
9783838521732
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Genre
Veröffentlichung
21.01.2009
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
424
Auflage
2. überarb. Aufl.
Lesemotiv
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.