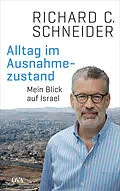»Alltag im Ausnahmezustand« ist das Porträt eines Landes, das hin- und her gerissen ist zwischen Normalität und Ausnahmezustand, zwischen Konsum und Krieg, zwischen der Sehnsucht nach Frieden und dem Bedürfnis nach Sicherheit.
Richard C. Schneider bereist als Journalist seit über 30 Jahren den Nahen Osten und war von 2006 bis 2015 als Leiter und Chefkorrespondent des ARD-Studios Tel Aviv verantwortlich für Israel und die palästinensischen Gebiete. In seiner Analyse konzentriert er sich vor allem auf die komplexe und komplizierte Entwicklung der israelischen Gesellschaft in den vergangenen Jahren. Zwischen Hightech-Hub und religiösem Fundamentalismus droht die israelische Gesellschaft in jeder Richtung extremer und radikaler zu werden, nicht zuletzt auch durch die Bedrohungen von außen.
Richard C. Schneider, geboren 1957, ist Journalist, Buch- und Fernsehautor. Er war von 2006 bis 2015 ARD-Studioleiter und Chefkorrespondent in Tel Aviv, 2016 Leiter TV und Chefkorrespondent im ARD Studio Rom, und arbeitet jetzt wieder als Editor-at-large und Filmemacher für die ARD. Zudem schreibt er als SPIEGEL-Autor regelmäßig über Israel und den Nahen Osten. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit dem Nahostkonflikt, der israelischen Gesellschaft und der jüdischen Geschichte. Zuletzt sind von ihm erschienen 'Alltag im Ausnahmezustand. Mein Blick auf Israel' (DVA 2018) und der Film 'Die Sache mit den Juden' (2021) über unterschiedliche Formen des Antisemitismus in Deutschland.
Große Aufmerksamkeit rund um den 70. Jahrestag der Staatsgründung im Mai 2018
Autorentext
Richard C. Schneider, geboren 1957, ist Journalist, Buch- und Fernsehautor. Er war von 2006 bis 2015 ARD-Studioleiter und Chefkorrespondent in Tel Aviv, 2016 Leiter TV und Chefkorrespondent im ARD Studio Rom, und arbeitete bis Ende 2022 als Editor-at-large und Filmemacher für die ARD. Zudem schreibt er als SPIEGEL-Autor regelmäßig über Israel und den Nahen Osten. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit dem Nahostkonflikt, der israelischen Gesellschaft und der jüdischen Geschichte. Zuletzt sind von ihm erschienen »Alltag im Ausnahmezustand. Mein Blick auf Israel« (DVA 2018), »Wie hättet ihr uns denn gerne?« (2022, zusammen mit Özlem Topçu) und die vierteilige Dokumentarserie »Die Sache mit den Juden« (2021) über unterschiedliche Formen des Antisemitismus in Deutschland. Richard C. Schneider lebt nach Jahren in Tel Aviv heute wieder in München.
Leseprobe
Einführung
1948-2018. Siebzig Jahre und kein Ende in Sicht
Nie werde ich diesen Tag vergessen. Ein warmer Frühlingstag in München, Anfang Juni. Ich war gerade aus der Schule nach Hause gekommen, war wie immer als erstes in mein Zimmer gegangen, um die Schultasche abzulegen, um dann mit meinen Eltern in der Küche gemeinsam zu Mittag zu essen. Doch meine Mutter war sofort in mein Zimmer gekommen, ich hatte meinen Schulranzen noch in der Hand. Sie sah mich sehr ernst an und sagte nur: »In Israel ist Krieg. Die Araber haben angegriffen.« Es war der 5. Juni 1967, ich war zehn Jahre alt. Ich wusste nicht genau, welche Konsequenzen dieser Krieg haben würde. Aber ich dachte sofort an Napalm und verbrannte Kinder - Bilder aus dem Vietnamkrieg, die bei uns täglich während des Abendessens über den Schwarz-Weiß-Fernseher ins Wohnzimmer eindrangen. Diese Bilder kannte ich gut, sie gehörten zu meinen Kinder- und Jugendjahren wie eine Hintergrundmusik im Kino, eine Art Leitmotiv. Man nimmt sie kaum wahr, doch sie ist immer da. Der Vietnamkrieg. Irgendwie nah und doch weit weg. Vietnam. Wo lag das? Zum Glück waren da keine Juden und keine Deutsche involviert, keine Nazis, sondern Amerikaner, und die waren doch schließlich die Guten, hatten die nicht Hitler besiegt und somit meinen Eltern das Leben gerettet? Dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter von der Roten Armee gerettet wurden, hatte ich zwar gehört, schließlich waren meine Eltern in Konzentrationslagern der Nazis in Osteuropa gewesen, aber ich wusste auch, dass meine Eltern nach dem Krieg zweimal vor den Kommunisten aus der Tschechoslowakei und Ungarn fliehen mussten, ehe sie endlich im Westen ankamen. Und dass die Russen Antisemiten waren, das hatte ich auch gehört. Und dass sie Frauen in den befreiten KZ vergewaltigt hatten, das auch. Also: die USA. Nur die USA. Und die USA waren in der Tagesschau, aber vor allem waren sie im Radio täglich präsent mit der heißesten Musik, die man in Deutschland hören konnte. Im AFN, dem amerikanischen Armeesender. AFN prägte meine Generation in Deutschland. Wolfman Jack war unser Idol. Denn in Deutschland, da gab's nur Vico Torriani, Peter Alexander und Lou van Burg. Also, was konnte schlecht an den USA sein? Amerika war der Garant für Freiheit und Zukunft. Ein Land mit vielen Juden und ohne Antisemitismus, davon war ich überzeugt. Also mussten die GIs im Vietnamkrieg auch für die gute Sache kämpfen. Ich erschrak zwar, wenn ich brennende Kinder sah, aber ich konnte kaum glauben, dass die USA dafür verantwortlich waren, und wenn, dann geschah dies wohl eher aus Versehen als mit Absicht. So dachte ich damals.
Aber letztendlich waren Franz Beckenbauer und Gerd Müller, Pierre Brice und Lex Barker in meiner Welt einfach wichtiger als irgendein Krieg, den ich nicht begriff, Lichtjahre von uns entfernt. Nun aber: Krieg gegen Israel. Ich hatte keine Vorstellung, welche Konsequenzen er weltpolitisch möglicherweise haben würde. Aber dass es um das Überleben des jüdischen Staates ging, dass dieser Krieg auch das Leben meiner Familie betraf, das war mir sofort klar. Und so ließ ich den Schulranzen in meiner Hand einfach auf den Boden fallen und blickte meine Mutter unsicher an. Ich war gerade mal ein halbes Jahr zuvor das erste Mal in Israel gewesen, mit meinem Vater, wir wohnten bei seiner Cousine Piri im Galil und reisten durch das Land. Ich besuchte all die Orte, die ich aus dem Religionsunterricht und dem Gebet kannte. Nur den Tempelberg mit der Klagemauer, dem Stück Westmauer des Zweiten Tempels, den konnte ich nicht besuchen. Er lag in Ostjerusalem, war damals noch in jordanischer Hand. Ich stand mit meinem Vater an der stacheldrahtüberzogenen Grenzlinie zwischen West- und Ostjerusalem, ganz in der Nähe des Mandelbaumtors, da deute