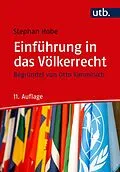Das bewährte Standardwerk beschreibt leicht verständlich und umfassend die Neuentwicklungen des Völkerrechts im Zeitalter der Globalisierung. Es thematisiert zahlreiche aktuelle Problembereiche wie etwa den virtuellen Raum, die Frage nach dem Zugang zu Rohstoffen und den Umgang mit kolonial erbeuteten Kulturgütern. Zudem hat ein eigenständiges Unterkapitel zum Entwicklungsvölkerrecht Eingang in das Werk gefunden. Neben der durchgehenden Aktualisierung wurden unter anderem die Kapitel über das Recht der internationalen Wirtschaftsordnung, die Menschenrechte, das Völkerstrafrecht oder auch das Umweltvölkerrecht besonders überarbeitet. Großer Wert wurde auf Benutzerfreundlichkeit durch zahlreiche Übersichten, Querverweise und Literaturhinweise gelegt. Der Überprüfung des erworbenen Wissens dienen online zur Verfügung stehende Wiederholungs- und Verständnisfragen, die auf die relevanten Stellen des Lehrbuchs verweisen. Auch eine umfangreiche Liste mit vertiefender Literatur zu den einzelnen Kapiteln ist online einsehbar. "Ein hervorragendes Lehrbuch, welches sich primär an eine im Studium befindliche Leserschar richtet. Aufgrund seines durchdachten, didaktischen Stils kann es auch Nicht-Juristen, die sich mit dem Völkerrecht zu befassen haben, empfohlen werden." HuV | Humanitäres Völkerrecht
Autorentext
Prof. Dr. Stephan Hobe ist Direktor des Instituts für Luftrecht,Weltraumrecht und Cyberrecht.
Inhalt
Vorwort V Abkürzungsverzeichnis XVII Materialien zum Studium des Völkerrechts XXIX 1. Grundlagen 1 1.1 Relevanz des Völkerrechts 1 1.2 Zur theoretischen Einordnung des Völkerrechts 6 1.3 Entfaltung und gegenwärtiger Stand des Völkerrechts im Zeitalter der Globalisierung 12 1.3.1 Eingrenzungsprobleme 12 1.3.2 Vorformen des Völkerrechts in der Antike 13 1.3.3 Die abendländische Rechtsgemeinschaft im Mittelalter 15 1.3.4 Das klassische Völkerrecht 20 1.3.5 Das moderne Völkerrecht 26 1.3.5.1 Die Völkerbundsära nach Ende des Ersten Weltkrieges 26 1.3.5.2 Die Ära der Vereinten Nationen nach Ende des Zweiten Weltkriegs 31 1.3.5.3 Völkerrecht im Umbruch: Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts 36 2. Die Völkerrechtssubjektivität 45 2.1 Die souveränen Staaten als Völkerrechtssubjekte 49 2.1.1 Der Staat im Völkerrecht die Elemente des Staatsbegriffs 49 2.1.2 Die Anerkennung 52 2.1.3 Das Staatsgebiet 58 2.1.4 Erwerb und Verlust von Staatsgebiet 62 2.1.5 Das Staatsvolk: Staatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit und Fremdenrecht 66 2.1.6 Die Staatsgewalt: Der Grundsatz der Gebietsausschließlichkeit 75 2.1.7 Die Staatensukzession 82 2.1.7.1 Begriff und Bedeutung 82 2.1.7.2 Kodifikationsbestrebungen 84 2.1.7.3 Grundsätze 85 2.1.7.4 Die Wiedervereinigung Deutschlands im Lichte der Regeln über die Staatennachfolge 89 2.1.8 Exkurs: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker 90 2.2 Staatenverbindungen 96 2.2.1 Definitionen 96 2.2.2 Internationale Organisationen 99 2.2.3 Insbesondere: Die Organisation der Vereinten Nationen 102 2.2.3.1 Allgemeines 102 2.2.3.2 Organe 104 2.2.3.3 Sonderorganisationen 109 2.2.3.4 Exkurs: Die Debatte um die Reform der Vereinten Nationen 110 2.2.4 Regionale und supranationale Organisationen 113 2.2.4.1 Der Europarat 114 2.2.4.2 Die North Atlantic Treaty Organization 114 2.2.4.3 Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 115 2.2.4.4 Die Organisation Amerikanischer Staaten 118 2.2.4.5 Die Arabische Liga 118 2.2.4.6 Die Afrikanische Union 118 2.2.4.7 Die Europäische Union 119 2.3 Sonderfälle der Völkerrechtssubjektivität 120 2.3.1 Der Heilige Stuhl 120 2.3.2 Der Souveräne Malteserorden 121 2.3.3 Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 122 2.4 Andere Rechtsstellungen im Völkerrecht 124 2.4.1 Nichtstaatliche internationale Organisationen 124 2.4.2 Transnationale Unternehmen 127 2.4.3 Das Individuum 129 2.4.4 Völker, Volksgruppen, Minderheiten und indigene Völker 133 2.4.5 Das de facto-Regime, Aufständische und Kriegführende sowie Befreiungsbewegungen 136 3. Völkerrechtsquellen 139 3.1 Allgemeiner Überblick 139 3.2 Verträge 141 3.2.1 Kategorien völkerrechtlicher Verträge 143 3.2.2 Völkerrechtliche Verträge und Soft Law 145 3.3 Völkerrechtliches Recht der Verträge 147 3.3.1 Zustandekommen 148 3.3.1.1 Verhandlungsvollmacht 148 3.3.1.2 Vertragsabschluss und dessen Vorwirkungen 149 3.3.2 Inkrafttreten 152 3.3.3 Wirkung gegenüber Dritten 152 3.3.4 Vorbehalte 154 3.3.4.1 Voraussetzungen 155 3.3.4.2 Rechtsfolgen eines unzulässigen Vorbehalts 157 3.3.4.3 Wirkung von Vorbehalten 158 3.3.5 Interpretation/Auslegung von völkerrechtlichen Verträgen 159 3.3.6 Willensmängel und Gewaltanwendung 160 3.3.7 Vertragsbruch 161 3.3.8 Vertragsbeendigung 161 3.3.9 Vertragskollision 163 3.3.10 Sonderfall: Vertragsrecht internationaler Organisationen 163 3.4 Gewohnheitsrecht 164 3.4.1 Entstehungsvoraussetzungen 164 3.4.1.1 Objektives Element: Praxis 164 3.4.1.2 Rechtsüberzeugung 166 3.4.1.3 Sog. Persistent Objector-Regel 168 3.4.2 Entwicklungen 168 3.4.3 Geltungsverlust und Änderung 170 3.5 Die allgemeinen Rechtsgrundsätze 171 3.6 Ius cogens und Hierarchie der Rechtsquellen 173 3.7 Hilfsmittel zur Feststellung von Völkerrechtsnormen 178 3.8 Die Kodifikation des Völkerrechts 179 3.9 Die Resolutionen der UN-Organe 181 3.10 Sog. Soft Law 183 3.11 Einseitige Handlungen 186 4. Völkerrecht und innerstaatliches Recht 193 4.1 Die Theorien zum Verhältnis von Völkerrecht und innerstaatlichem Recht und ihre praktischen Auswirkungen 193 4.1.1 Die monistische Theorie mit Primat des innerstaatlichen Rechts 193 4.1.2 Die monistische Theorie mit Primat des Völkerrechts 194 4.1.3 Die dualistische Theorie 194 4.1.4 Der gemäßigte Dualismus 194 4.2 Das Verhältnis von Völkerrecht und innerstaatlichem Recht nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 198 4.2.1 Die Bindung an die allgemeinen Regeln des Völkerrechts 198 4.2.2 Die Transformation von Völkervertragsrecht in deutsches Bundesrecht 200 4.2.3 Der Grundsatz der Völker- und Europarechtsfreundlichkeit 202 5. Die Grundprinzipien der zwischenstaatlichen Beziehungen Gewaltverbot/ Interventionsverbot/ Gegenseitigkeit/Zusammenarbeit 205 5.1 Das Gewaltverbot als Konkretisierung der Pflicht zur Erhaltung des Weltfriedens 205 5.1.1 Entstehungsgeschichte 205 5.1.2 Anwendungsbereich 207 5.1.3 Ausnahme: Das Selbstverteidigungsrecht 211 5.1.3.1 Geschichte und Entwicklung des Selbstverteidigungsrechts 211 5.1.3.2 Der Tatbestand des Art. 51 UN-Charta 212 5.1.3.3 Grenzen des Art. 51 UN-Charta 213 5.1.3.4 Kollektive Selbstverteidigung 216 5.1.3.5 Präventive Selbstverteidigung 216 5.1.3.6 Selbsthilfe bei der Rettung eigener Staatsbürger 220 5.1.3.7 Selbstverteidigung gegen terroristische Angriffe 221 5.1.4 Ausnahme: Kollektive Sicherheit 222 5.1.4.1 Das System der kollektiven Sicherheit 223 5.1.4.2 Die Konzeption der UN-Charta 223 5.1.4.3 Humanitäre Intervention mit UN-Autorisierung 229 5.1.5 Weitere Ausnahme: Humanitäre Intervention ohne UN-Mandat? 231 5.1.6 Die Schutzverantwortung (Responsibility to Protect) 232 5.1.7 Anhang: Friedenssicherungsmaßnahmen 233 5.1.7.1 Friedenssicherung durch Friedenstruppen 233 5.1.7.2 Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Krisengebieten 238 5.2 Das Interventionsverbot als Konkretisierung des Grundsatzes der souveränen Staatengleichheit 239 5.2.1 Anwendungsbereich und Abgrenzung 240 5.2.2 Das Interventionsverbot im Verhältnis der Vereinten Nationen zu ihren Mitgliedstaaten 242 5.2.3 Weitere Konsequenzen aus dem Grundsatz der souveränen Staatengleichheit 243 5.2.3.1 Bindung an das Völkerrecht 243 5.2.3.2 Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und Konferenzen 243 5.2.3.3 Gerichtsbarkeit anderer Staaten 243 5.2.3.4 Act of State Doctrine 244 5.2.3.5 Insbesondere: Immunitäten 244 5.2.4 Exkurs: Cyberwar als Eingriff in die staatliche Souveränität 247 5.3 Das Prinzip der Gegenseitigkeit 248 5.4 Pflicht der Staaten zur gegenseitigen Zusammenarbeit 250 6. Reaktionen auf die Verletzung des Völkerrechts 255 6.1 Mechanismen des Rechtsvollzu…
Autorentext
Prof. Dr. Stephan Hobe ist Direktor des Instituts für Luftrecht,Weltraumrecht und Cyberrecht.
Inhalt
Vorwort V Abkürzungsverzeichnis XVII Materialien zum Studium des Völkerrechts XXIX 1. Grundlagen 1 1.1 Relevanz des Völkerrechts 1 1.2 Zur theoretischen Einordnung des Völkerrechts 6 1.3 Entfaltung und gegenwärtiger Stand des Völkerrechts im Zeitalter der Globalisierung 12 1.3.1 Eingrenzungsprobleme 12 1.3.2 Vorformen des Völkerrechts in der Antike 13 1.3.3 Die abendländische Rechtsgemeinschaft im Mittelalter 15 1.3.4 Das klassische Völkerrecht 20 1.3.5 Das moderne Völkerrecht 26 1.3.5.1 Die Völkerbundsära nach Ende des Ersten Weltkrieges 26 1.3.5.2 Die Ära der Vereinten Nationen nach Ende des Zweiten Weltkriegs 31 1.3.5.3 Völkerrecht im Umbruch: Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts 36 2. Die Völkerrechtssubjektivität 45 2.1 Die souveränen Staaten als Völkerrechtssubjekte 49 2.1.1 Der Staat im Völkerrecht die Elemente des Staatsbegriffs 49 2.1.2 Die Anerkennung 52 2.1.3 Das Staatsgebiet 58 2.1.4 Erwerb und Verlust von Staatsgebiet 62 2.1.5 Das Staatsvolk: Staatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit und Fremdenrecht 66 2.1.6 Die Staatsgewalt: Der Grundsatz der Gebietsausschließlichkeit 75 2.1.7 Die Staatensukzession 82 2.1.7.1 Begriff und Bedeutung 82 2.1.7.2 Kodifikationsbestrebungen 84 2.1.7.3 Grundsätze 85 2.1.7.4 Die Wiedervereinigung Deutschlands im Lichte der Regeln über die Staatennachfolge 89 2.1.8 Exkurs: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker 90 2.2 Staatenverbindungen 96 2.2.1 Definitionen 96 2.2.2 Internationale Organisationen 99 2.2.3 Insbesondere: Die Organisation der Vereinten Nationen 102 2.2.3.1 Allgemeines 102 2.2.3.2 Organe 104 2.2.3.3 Sonderorganisationen 109 2.2.3.4 Exkurs: Die Debatte um die Reform der Vereinten Nationen 110 2.2.4 Regionale und supranationale Organisationen 113 2.2.4.1 Der Europarat 114 2.2.4.2 Die North Atlantic Treaty Organization 114 2.2.4.3 Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 115 2.2.4.4 Die Organisation Amerikanischer Staaten 118 2.2.4.5 Die Arabische Liga 118 2.2.4.6 Die Afrikanische Union 118 2.2.4.7 Die Europäische Union 119 2.3 Sonderfälle der Völkerrechtssubjektivität 120 2.3.1 Der Heilige Stuhl 120 2.3.2 Der Souveräne Malteserorden 121 2.3.3 Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 122 2.4 Andere Rechtsstellungen im Völkerrecht 124 2.4.1 Nichtstaatliche internationale Organisationen 124 2.4.2 Transnationale Unternehmen 127 2.4.3 Das Individuum 129 2.4.4 Völker, Volksgruppen, Minderheiten und indigene Völker 133 2.4.5 Das de facto-Regime, Aufständische und Kriegführende sowie Befreiungsbewegungen 136 3. Völkerrechtsquellen 139 3.1 Allgemeiner Überblick 139 3.2 Verträge 141 3.2.1 Kategorien völkerrechtlicher Verträge 143 3.2.2 Völkerrechtliche Verträge und Soft Law 145 3.3 Völkerrechtliches Recht der Verträge 147 3.3.1 Zustandekommen 148 3.3.1.1 Verhandlungsvollmacht 148 3.3.1.2 Vertragsabschluss und dessen Vorwirkungen 149 3.3.2 Inkrafttreten 152 3.3.3 Wirkung gegenüber Dritten 152 3.3.4 Vorbehalte 154 3.3.4.1 Voraussetzungen 155 3.3.4.2 Rechtsfolgen eines unzulässigen Vorbehalts 157 3.3.4.3 Wirkung von Vorbehalten 158 3.3.5 Interpretation/Auslegung von völkerrechtlichen Verträgen 159 3.3.6 Willensmängel und Gewaltanwendung 160 3.3.7 Vertragsbruch 161 3.3.8 Vertragsbeendigung 161 3.3.9 Vertragskollision 163 3.3.10 Sonderfall: Vertragsrecht internationaler Organisationen 163 3.4 Gewohnheitsrecht 164 3.4.1 Entstehungsvoraussetzungen 164 3.4.1.1 Objektives Element: Praxis 164 3.4.1.2 Rechtsüberzeugung 166 3.4.1.3 Sog. Persistent Objector-Regel 168 3.4.2 Entwicklungen 168 3.4.3 Geltungsverlust und Änderung 170 3.5 Die allgemeinen Rechtsgrundsätze 171 3.6 Ius cogens und Hierarchie der Rechtsquellen 173 3.7 Hilfsmittel zur Feststellung von Völkerrechtsnormen 178 3.8 Die Kodifikation des Völkerrechts 179 3.9 Die Resolutionen der UN-Organe 181 3.10 Sog. Soft Law 183 3.11 Einseitige Handlungen 186 4. Völkerrecht und innerstaatliches Recht 193 4.1 Die Theorien zum Verhältnis von Völkerrecht und innerstaatlichem Recht und ihre praktischen Auswirkungen 193 4.1.1 Die monistische Theorie mit Primat des innerstaatlichen Rechts 193 4.1.2 Die monistische Theorie mit Primat des Völkerrechts 194 4.1.3 Die dualistische Theorie 194 4.1.4 Der gemäßigte Dualismus 194 4.2 Das Verhältnis von Völkerrecht und innerstaatlichem Recht nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 198 4.2.1 Die Bindung an die allgemeinen Regeln des Völkerrechts 198 4.2.2 Die Transformation von Völkervertragsrecht in deutsches Bundesrecht 200 4.2.3 Der Grundsatz der Völker- und Europarechtsfreundlichkeit 202 5. Die Grundprinzipien der zwischenstaatlichen Beziehungen Gewaltverbot/ Interventionsverbot/ Gegenseitigkeit/Zusammenarbeit 205 5.1 Das Gewaltverbot als Konkretisierung der Pflicht zur Erhaltung des Weltfriedens 205 5.1.1 Entstehungsgeschichte 205 5.1.2 Anwendungsbereich 207 5.1.3 Ausnahme: Das Selbstverteidigungsrecht 211 5.1.3.1 Geschichte und Entwicklung des Selbstverteidigungsrechts 211 5.1.3.2 Der Tatbestand des Art. 51 UN-Charta 212 5.1.3.3 Grenzen des Art. 51 UN-Charta 213 5.1.3.4 Kollektive Selbstverteidigung 216 5.1.3.5 Präventive Selbstverteidigung 216 5.1.3.6 Selbsthilfe bei der Rettung eigener Staatsbürger 220 5.1.3.7 Selbstverteidigung gegen terroristische Angriffe 221 5.1.4 Ausnahme: Kollektive Sicherheit 222 5.1.4.1 Das System der kollektiven Sicherheit 223 5.1.4.2 Die Konzeption der UN-Charta 223 5.1.4.3 Humanitäre Intervention mit UN-Autorisierung 229 5.1.5 Weitere Ausnahme: Humanitäre Intervention ohne UN-Mandat? 231 5.1.6 Die Schutzverantwortung (Responsibility to Protect) 232 5.1.7 Anhang: Friedenssicherungsmaßnahmen 233 5.1.7.1 Friedenssicherung durch Friedenstruppen 233 5.1.7.2 Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Krisengebieten 238 5.2 Das Interventionsverbot als Konkretisierung des Grundsatzes der souveränen Staatengleichheit 239 5.2.1 Anwendungsbereich und Abgrenzung 240 5.2.2 Das Interventionsverbot im Verhältnis der Vereinten Nationen zu ihren Mitgliedstaaten 242 5.2.3 Weitere Konsequenzen aus dem Grundsatz der souveränen Staatengleichheit 243 5.2.3.1 Bindung an das Völkerrecht 243 5.2.3.2 Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und Konferenzen 243 5.2.3.3 Gerichtsbarkeit anderer Staaten 243 5.2.3.4 Act of State Doctrine 244 5.2.3.5 Insbesondere: Immunitäten 244 5.2.4 Exkurs: Cyberwar als Eingriff in die staatliche Souveränität 247 5.3 Das Prinzip der Gegenseitigkeit 248 5.4 Pflicht der Staaten zur gegenseitigen Zusammenarbeit 250 6. Reaktionen auf die Verletzung des Völkerrechts 255 6.1 Mechanismen des Rechtsvollzu…
Titel
Einführung in das Völkerrecht
Autor
EAN
9783838553719
Format
E-Book (pdf)
Hersteller
Veröffentlichung
11.05.2020
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Anzahl Seiten
650
Auflage
11. überarb. u. aktual. Aufl.
Lesemotiv
Unerwartete Verzögerung
Ups, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.