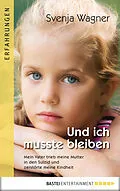Svenja Wagner wurde 1969 in Menden als Kind zweier Lehrer geboren. Mit 17 lief sie von zu Hause weg und lebte ein Jahr bis zu ihrer Volljährigkeit abwechselnd auf der Straße und bei einem Bekannten. Anschließend zog sie nach München, wo sie nach zwei längeren Auslandsaufenthalten zuletzt als Personalreferentin arbeitete. 2013 begann sie ein Studium der Psychologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität München.
Autorentext
Svenja Wagner wurde 1969 in Menden als Kind zweier Lehrer geboren. Mit 17 lief sie von zu Hause weg und lebte ein Jahr bis zu ihrer Volljährigkeit abwechselnd auf der Straße und bei einem Bekannten. Anschließend zog sie nach München, wo sie nach zwei längeren Auslandsaufenthalten zuletzt als Personalreferentin arbeitete. 2013 begann sie ein Studium der Psychologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität München.
Leseprobe
1
Hallo, Welt!
Weit im Westen Deutschlands, rund siebzig Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt, existiert eine kleine, 1952 Einwohner umfassende Siedlung. Es ist einer jener beliebig wirkenden Orte, an denen Tausende von Reisenden tagein, tagaus mit dem Zug vorbeifahren und nicht ahnen, was wirklich hinter den gutbürgerlichen Fassaden vor sich geht.
Wenn ich an das Dorf meiner Kindheit zurückdenke, sehe ich gleich rechts hinter dem Ortseingangsschild fade Verwaltungsgebäude und Fertigungshallen, um die herum sich einige Mehrfamilienhäuser gruppierten. In den Hinterhöfen standen die obligatorischen Teppichklopfstangen, zu hoch für uns Kinder, um an ihnen zu turnen. Verwitterte Scherenzäune zerteilten die asphaltierte Fläche, auf der man wunderbar hätte Rollschuh fahren können, in exakt abgemessene Parzellen für die Wäscheleinen. An der Straße Richtung Ortsende reihten sich die Einfamilienhäuser, der grobe Putz angegraut, die Jalousien halb heruntergezogen. Gartenzwerge grinsten einem aus den Vorgärten entgegen, während die windschiefen Lauben und selbst gezimmerten Eingangsvorbauten auf etliche Hobbyheimwerker im Dorf schließen ließen. Der wahrscheinlich leidenschaftlichste von ihnen war mein Vater.
Unser Haus war wohl selbst in seiner Blüte nie eine Schönheit gewesen, weshalb es für meinen Vater nicht ganz einfach gewesen sein dürfte, meine Mutter zu diesem Kauf zu überreden. Es musste komplett saniert werden, was einige Zeit in Anspruch nahm, und als Papa mit dem Nötigsten fertig war, hatte er offenbar seinen Spaß am Heimwerken gefunden. Er ging voll und ganz in seinen Projekten auf und fand immer wieder ein Fleckchen zum Anbauen, Umbauen, Draufbauen und Wieder-Abreißen. Im Nachhinein kommt es mir so vor, als hätte er in dem kleinen Anwesen mit seinem verwinkelten Keller, dem düsteren Werkzeugraum und dem viel zu großen Treibhaus sein ganz persönliches Legoland gefunden, in dem er sich nach Lust und Laune austoben konnte. Vielleicht war es aber auch eine Flucht vor sich selbst, die er dort betrieb.
Meine Eltern hatten sich während des Studiums für das Lehramt kennengelernt; mein Vater war Hauptschullehrer, meine Mutter Grundschullehrerin. Mami war nicht gerade glücklich gewesen, nach dem Staatsexamen mitten ins Niemandsland versetzt zu werden. Mein Vater jedoch war in dieser Hinsicht weniger wählerisch. Er schätzte die viele Freizeit, die sein Beruf mit sich brachte, liebte sein Hobby und wollte ansonsten in Ruhe gelassen werden.
Meine Mutter war völlig anders als er. Sie liebte alles, was mit Kunst und Kultur zu tun hatte, und so schwärmte sie von Städten wie Brüssel, ihrer Geburtsstadt, von Paris, Hamburg und München mit all den Möglichkeiten, welche diese Metropolen einem kulturbegeisterten Menschen boten. Bei uns auf dem Land hingegen war der Höhepunkt die monatliche Feuerwehrübung in der übernächsten Kleinstadt - sofern man nicht Mitglied im ortseigenen Schützenverein war. Und auch ästhetisch konnte die ehemalige Arbeitersiedlung mit ihrem Wellblechlauben-Charme und dem abgenutzten Sechzigerjahre-Ambiente meiner Mutter wohl kaum Begeisterungsstürme entlocken. Doch wenn ihr etwas noch wichtiger war als die Kunst, so waren es mein Vater und ich. Als Mitglied einer deutschen Familie hatte sie als kleines Mädchen die Flucht aus Belgien miterlebt. Sie kannte das Gefühl, alles verloren zu haben, nirgends willkommen und immer nur geduldet zu sein. Und so arrangierte sie sich mit dem Leben im Dorf und versuchte, uns ein Heim zu schaffen - voller Geborgenheit, Lebendigkeit und Fantasie.
Was ihr dabei half, war die Nähe zur Natur. Das mit Abstand Schönste, gleichzeitig aber wohl auch das Symptomatische an dem Ort meiner Kindheit waren der Wald und die Felder, die ihn fast vollständig vom Rest der Welt abzutrennen schienen. Nur über eine einzige Straße gelangte man aus dem Dorf hinaus, und diese führte über die Gleise. Verbunden