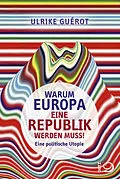Ulrike Guérot, geb. 1964, Politikwissenschaftlerin, Gründerin und Direktorin des European Democracy Labs an der European School of Governance, eusg, in Berlin und seit Frühjahr 2016 Professorin und Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems/Österreich. Sie hat zwanzig Jahre in Thinktanks in Paris, Brüssel, London, Washington und Berlin zu Fragen der europäischen Integration und Europas in der Welt gearbeitet und kennt EU-Europa, seine Institutionen und Schwächen wie kein(e) zweite(r).
Autorentext
Ulrike Guérot, born in 1964, is a political scientist, Professor of European Policy and the Study of Democracy at Danube-University Krems (Austria), and Founder of the European Democracy Lab (EuDemLab), Berlin. She has been dealing with the future of European democracy for many years and is an expert on the EU, its institutions and weaknesses. www.eudemlab.org
Leseprobe
KAPITEL 5
Falsche Lösungen oder:Ein System im Leerlauf
»Wir wissen alle, was zu tun ist, aber wir können es nicht tun«
Jean-Claude Juncker, mit Blick auf die Integrationsnotwendigkeit der Eurozone
»Die Zeiten, in denen das Alte noch nicht sterben kann und das Neue noch nicht werden kann, sind die Zeiten der Monster.«
Antonio Gramsci
Wo die Sprache und die Begriffe versagen, kann die politische Ästhetik, kann die europäische Einigung nicht gefunden werden. Begriffe konturieren das Denken, sie geben die Lösungen vor. Ohne richtige Sprache keine richtige Politik. Machen wir einen kleinen Streifzug durch die aktuellen EU-Krisenlösungsstrategien.
Der Dschungel der europäischen Wirtschaftspolitiken
Zuerst die sogenannten europäischen Wirtschaftspolitiken. Im Zuge der Eurokrise wurden sie in »Six-Packs«, »Two-Packs« und so weiter gegossen, mit einer Detailverliebtheit, die nationalen Regierungen nie einfallen würde. Niemand käme auf die Idee, im Bundestag die Lizenzvergabe von Taxibetrieben zu verordnen oder feste Zielvorgaben für die Beschäftigung von über Sechzigjährigen zu geben. Selbst Insider bezeichnen diese Strategiepapiere als Beschäftigungstherapie für Beamte. Wer sich einmal EU-Ratsbeschlüsse oder etwa die »Europäische Wachstumsstrategie« anschaut, dem wird das schnell klar. Das Gros der europäischen Wirtschaftspolitiken ist im Grund nur nationales Geld in europäisches Papier gewickelt und doppelt verbucht: die Versuche der makroökonomischen Koordinierung, der gemeinsamen Wirtschaftspolitik oder der Benchmark- und Peer-review-Prozesse, die mit großem bürokratischen Aufwand und viel Popanz in Brüssel zelebriert werden, oder die Brüsseler Hilfspakete wie etwa der Juncker-Investitionsplan von 2015 oder die 6 Milliarden europäische Soforthilfe zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit von 2013.
Markt ohne Gemeinwohl
Das zweite Übel liegt in einer ausschließlich auf Marktprinzipien ausgerichteten Binnenmarktpolitik (Effizienz und Wettbewerb, market-driven und consumer-driven), die nicht in der Lage ist, öffentliche Güter wie Infrastruktur, Transportnetze oder Energie europaweit bereitzustellen. Damit fällt die öffentliche Versorgung vor allem der ländlichen Regionen zwischen den nationalen und den europäischen Stuhl. Viele europäische Staaten können die Versorgung ihrer ländlichen Regionen nicht mehr garantieren: Die EU ihrerseits darf keine Kredite für die Bereitstellung von Infrastruktur aufnehmen, da sie kein Staat ist.59 In der Folge verwahrlosen die strukturschwachen, ländlichen Regionen fast überall in Europa. Vor allem sie sind das Opfer fehlender Staatlichkeit auf europäischer Ebene und des Abbaus von Staatlichkeit und öffentlicher Versorgung auf nationaler Ebene unter dem Druck europäischer Sparpolitik. Der öffentliche Diskurs fordert hier Strukturreformen in Europa. Wo aber in entvölkerten Gebieten nichts ist, kann auch nichts reformiert werden. Wenn in der Normandie ein Schlachthof zugemacht wird, stirbt eine ganze Region. Wer einmal auf der Autobahn von Dijon im französischen Osten nach Bordeaux in den französischen Westen durch 500 Kilometer Sonnenblumen gefahren ist oder wahlweise durch Andalusien, dem wird schnell klar, dass Strukturreformen einfach kein zielführender Begriff ist. So wurden von den 6 Milliarden Euro, die 2013 im Rahmen des Soforthilfeprogramms zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit bereitgestellt wurden, nur rund 25 Millionen abgerufen, und zwar einfach deshalb, weil sie in den südeuropäischen Regionen, die am stärksten betroffen waren, nirgendwo hinfließen konnten. In Deutschland hindert das übrigens niemanden daran, das duale Ausbildungswesen als europäischen Exportschlager zu feiern. Eine Volkswirtschaft aber