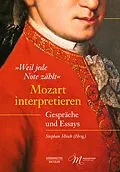Autorentext
Der Herausgeber Stephan Mösch ist Professor für Ästhetik, Geschichte und Künstlerische Praxis an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Bei Bärenreiter erschienen von ihm "Komponieren für Stimme. Von Monteverdi bis Rihm. Ein Handbuch" (BVK 2379) sowie "Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit. Wagners "Parsifal" in Bayreuth 18821933" (BVK 2326).
Klappentext
Warum brachen die Lutheraner nach der Reformation nicht mit der bestehenden Musikkultur? Bedeutete die Fortsetzung musikalischer Gewohnheiten und ihre diskursive Begründung reinen Pragmatismus, oder gab es einen Zusammenhang von Geschichtsverständnis, Traditionsbildung und musikalischer Praxis? Mit der Reformation ging eine Zunahme historiographischer Arbeiten einher, die die lutherische Konfession und die Reformen legitimierten. In diesen Diskurs waren Kirchenmusik und musikalische Praxis intrinsisch verwoben. Durch seine Traditionsbindung übernahm das Repertoire in Lübeck, Lüneburg und Schwerin eine identitätsstiftende Funktion. So entstand Repertoirebestand, der zwar nicht per se lutherisch ist, aber als solcher verstanden werden konnte und wurde. Christine Roth weist diese Zusammenhänge anhand detaillierter Repertoirestudien zu kirchlichen, schulischen und höfischen Musikpflege in Lübeck, Lüneburg und Schwerin nach.
Zusammenfassung
"Weil jede Note zählt": Dies ist das interpretatorisches Credo, das Alfred Brendel in diesem Buch entwirft. Es ist eine Aufforderung, über den Umgang mit Mozarts Musik nachzudenken, über das, was man gemeinhin "Interpretation" nennt und was sich in den letzten 100 Jahren immer wieder fundamental verändert hat. In Gesprächen und Essays formulieren weltberühmte Mozart-InterpretInnen und renommierte Musikforscher ihre Erfahrungen und Erkenntnisse: Was hieß es und was heißt es, Mozart aufzuführen? Aus dem Inhalt: - Wie schreibt Mozart? Über seine Partituren und seine Schaffensweise - Warum Spontaneität und Risiko so wichtig sind: Zur Aufführungspraxis - Mozarts Theater der Vielfalt: Fragen des menschlichen Daseins auf der Bühne - Von Richard Strauss bis Nikolaus Harnoncourt: Zur künstlerischen Physiognomie großer Mozart-Dirigenten - Wie haben sich Komponisten des 20. Jahrhunderts mit Mozart auseinandergesetzt? - Festspielgeschichte ist deutsche Geschichte: Ein Dokumentarteil zum Mozartfest Würzburg Gespräche von Markus Thiel mit Alfred Brendel, John Eliot Gardiner, Christian Gerhaher, Brigitte Fassbaender, Hartmut Haenchen, Markus Hinterhäuser, René Jacobs, Frank Peter Zimmermann und Tabea Zimmermann Autoren der Essays Ulrich Konrad, Robert D. Levin, Stephan Mösch, Wolfgang Rathert und Thomas Seedorf Dokumentarteil Hansjörg Ewert, Christian Lemmerich, Dimitra Will, Renate Ulm In Zusammenarbeit mit dem Mozartfest Würzburg, das 2021 seinen 100. Geburtstag feiert. "Mozart braucht unsere Ehrungen nicht wir brauchen ihn und seinen aufwühlenden Sturmwind Was ist der Inhalt seines Plädoyers? Es ist die Kunst selbst, es ist die Musik, und wir haben Rechenschaft darüber abzulegen, was wir mit ihr gemacht haben und immer noch machen." (Nikolaus Harnoncourt, 2006).