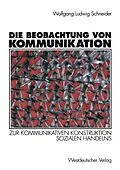Autorentext
Dr. Wolfgang Ludwig Schneider ist Privatdozent für Soziologie am soziologischen Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Klappentext
Handeln wird üblicherweise als intentionales Verhalten verstanden. Obwohl damit von Hause aus individuell und psychisch konstituiert, gelten Handlungen zugleich als Basiseinheiten des Sozialen. In der darin angezeigten, aber in der Regel mißachteten Differenz zwischen Handlung als Bewußtseinsleistung und Handlung als sozial erzeugter Einheit liegt der Ausgangspunkt dieser Untersuchung. Sie bildet den Hintergrund für die Diskussion maßgeblicher Positionen, die von der soziologischen und philosophischen Handlungstheorie über die Kriterien der Zurechnung von Handlungen im Recht bis hin zur Sprechakttheorie, Systemtheorie und Konversationsanalyse reichen.Wie wird die Identität einer Handlung sozial konstituiert? - So lautet dabei die Leitfrage, durch die der Autor Distanz zur üblichen handlungstheoretischen Diskussion gewinnt. Ihm geht es darum, wie Akteure es anstellen, das Verhalten anderer Akteure als Vollzug bestimmter Handlungen zu verstehen. Die Antwort verweist auf Kommunikation. Sie ist der "Ort", wo Handlungen aus unterschiedlichen Perspektiven kongruent identifiziert und so als Synthese von Selbst- und Fremdzuschreibungen verfertigt werden können. Als "molekulare" Einheit der Erzeugung intersubjektiv bedeutungsgleicher Handlungen erweist sich eine triadische Kommunikationssequenz. In ihr sieht der Autor ein kommunikationstheoretisches Äquivalent zu einem psychisch konzipierten Handlungsbegriff, wie er - in klassischer Ausprägung für die Soziologie - von Max Weber vertreten worden ist.
Inhalt
1. Vom subjektiven Handlungsbegriff zur Fundierung des Handelns in der Interaktion.- 1.1 Handlung und soziale Beziehung bei Weber.- 1.2 Handlung und Interaktion bei Parsons.- 1.3 Handlung und soziale Beziehung bei Schütz.- 1.4 Handlung und Intention in der philosophischen Handlungstheorie.- 1.5 Kriterien für die Zurechnung von Ereignissen als Handlungen im Recht.- 1.6 Handlungen als Artefakte sozialer Definitionsprozesse.- 1.7 Handlungen als kommunikative Synthesen von Fremd- und Selbstzuschreibungen.- 1.8 Handeln und Erleben als komplementäre Zurechnungsschemata.- 2. Sprechhandlungen.- 2.1 Kommunikation als intentionales Handeln und gelingende Verständigung: J.R. Searle.- 2.2 Zur Struktur konstitutiver Regeln.- 2.3 Bedeutung als soziale Struktur: G.H. Mead.- 3. Die systemtheoretische Kommunikationstheorie Luhmanns.- 3.1 Die Luhmannsche Version des Problems doppelter Kontingenz in Differenz zu Parsons, Habermas und Searle.- 3.2 Der Kommunikationsbegriff in Luhmanns Systemtheorie.- 4. Die intersubjektive Konstituierung kommunikativer Handlungen.- 4.1 Dreizügige Sequenzen als minimale Einheiten der kommunikativen Reproduktion von Erwartungsstrukturen.- 4.2 Adjacency pairs und three-part-sequences in der Konversationsanalyse.- 4.3 Entlastung der Kommunikation von der Reproduktion von Intersubjektivität.- 5. Die kommunikative Ordnung divergierender Bedeutungsselektionen.- 5.1 Zur kommunikationstheoretischen Definition von Konflikt.- 5.2 Die Organisation divergierender Bedeutungsselektionen als Konflikt.- 5.3 Kontraintentionale Handlungen als Artefakte der Kommunikation und die kommunikative Katalyse von Motiven.- 5.4 Simulation inkongruenter Bedeutungsselektionen: Garfinkels Krisenexperimente.- 6. Die Erhebung von Geltungsansprüchen alskommunikative Synthesis von Bedeutungsselektionen.- 6.1 Behauptungen als Glieder von adjacency pairs.- 6.2 Die sequentielle Verfertigung von Geltungsansprüchen.- 6.3 Inkommensurabilität von Geltungsansprüchen durch divergierende Argumentationsrahmungen: Eine höherstufige Form der Inkongruenz von Bedeutungsselektionen.- 7. Resümee.- Literatur.- Register.