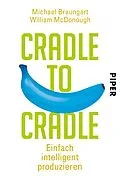Michael Braungart ist Chemiker und Präsident des Hamburger Umweltinsituts und Professor für Chemische Verfahrenstechnik und Stoffstrommanagement an der Fachhochschule Lüneburg sowie Wissenschaftlicher Leiter der 1987 von ihm gegründeten EPEA Internationale Umweltforschung GmbH in Hamburg. Er lehrt zurzeit an der University of Virginia und am MIT in Boston. William McDonough ist Professor für Architektur an der University of Virginia und Pionier für umweltverträgliche und menschenfreundliche Architektur. 1996 erhielt er den Preis für Nachhaltige Entwicklung, die höchste Ehrung für den Umweltschutz, die in den USA vom Präsidenten vergeben wird. Michael Braungart ist ein deutscher Verfahrenstechniker und Chemiker. Er entwickelte zusammen mit William McDonough das Cradle-to-cradle-Konzept. Braungart und McDonough erproben seit Jahren mit Firmen wie Ford, Nike, Unilever und BP erfolgreich die Realisierbarkeit ihrer Ideen.
Autorentext
Michael Braungart ist Chemiker und Präsident des Hamburger Umweltinsituts und Professor für Chemische Verfahrenstechnik und Stoffstrommanagement an der Fachhochschule Lüneburg sowie Wissenschaftlicher Leiter der 1987 von ihm gegründeten EPEA Internationale Umweltforschung GmbH in Hamburg. Er lehrt zurzeit an der University of Virginia und am MIT in Boston. William McDonough ist Professor für Architektur an der University of Virginia und Pionier für umweltverträgliche und menschenfreundliche Architektur. 1996 erhielt er den Preis für Nachhaltige Entwicklung, die höchste Ehrung für den Umweltschutz, die in den USA vom Präsidenten vergeben wird. Michael Braungart ist ein deutscher Verfahrenstechniker und Chemiker. Er entwickelte zusammen mit William McDonough das Cradle-to-cradle-Konzept. Braungart und McDonough erproben seit Jahren mit Firmen wie Ford, Nike, Unilever und BP erfolgreich die Realisierbarkeit ihrer Ideen.
Leseprobe
Michaels Geschichte
Ich stamme aus einer Familie, in der Geisteswissenschaften besonders geschätzt werden. Chemie begann mich erst zu interessieren, als wir in der zehnten Klasse eine junge und schöne Chemielehrerin bekamen. Seit Mitte der siebziger Jahre gab es in Deutschland eine politische Debatte über die Verwendung von Pestiziden und anderen problematischen Chemikalien sowie über Grenzen des Wachstums, so dass ich mein Studium gegenüber meiner Familie als sinnvoll rechtfertigen konnte. Ich studierte an Universitäten, an denen ich etwas über Umweltchemie lernen konnte, und wurde vor allem von Professor Friedhelm Korte beeinflusst, der wesentlich dazu beitrug, die »Ökologische Chemie« zu entwickeln. 1978 gehörte ich zu den Gründungsmitgliedern der »Grünen Aktion Zukunft«. Aus dieser ging die Partei der Grünen hervor, deren Hauptanliegen damals der Umweltschutz war.
Gleichzeitig machte ich mir einen Namen als Umweltschützer. Greenpeace, damals eine Gruppe von Aktivisten, unter denen kaum studierte Naturwissenschaftler oder Umweltforscher waren, bat mich, mitzuarbeiten. Ich leitete die Chemieabteilung von Greenpeace und verhalf der Organisation zu einem Protest auf wissenschaftlicher Grundlage. Doch schon bald wurde mir klar, dass es nicht ausreichte, zu protestieren und Probleme anzuprangern. Es müssen Lösungen gefunden werden. Für mich persönlich kam der Wendepunkt nach einer Protestaktion gegen eine Reihe von Chemieunfällen durch die damalig Schweizer Unternehmen Sandoz und Ciba-Geigy: Nachdem ein Feuer in einer riesigen Lagerhalle von Sandoz mit gefährlichen Chemikalien gelöscht und das giftige Löschwasser in den Rhein geflossen war und auf einer Strecke von über 160 Kilometern das Ökosystem des Flusses massiv geschädigt hatte, koordinierte ich eine Greenpeace-Aktion, bei der wir auf einen der Ciba-Geigy-Schornsteine in Basel kletterten. Als wir nach zwei Tagen unsere Aktion beendeten, empfing Anton Schaerli, der Direktor des Unternehmens, uns mit Blumen für die Aktivistinnen und heißer Suppe. Obwohl er die Art, wie wir unseren Protest zum Ausdruck gebracht hatten, ablehne, habe er sich Sorgen um unsere Sicherheit gemacht. Er teile persönlich unser Anliegen und wolle hören, was wir zu sagen hätten.
Es ergab sich daraus eine ganze Serie von Gesprächen mit dem Ciba-Geigy-Vorstand. Wir sprachen auch über meinen Plan, mit finanziellen Mitteln von Greenpeace ein Umweltinstitut zur Entwicklung von Lösungen zu gründen, das ich EPEA (Environmental Protection Enforcement Agency) nennen wollte. Der Direktor war begeistert und schlug eine kleine Änderung des Namens vor: »Encouragement« statt »Enforcement«. Das klinge nicht so feindselig und sei für Manager in Industrieunternehmen akzeptierbar. Ich beherzigte seinen Rat.
Und so wurde ich 1987 Leiter der EPEA (Internationale Umweltforschung GmbH), die Büros in mehreren Ländern einrichtete und die Beziehung zum Top-Management in diesem großen Unternehmen intensivierte.
Mit Unterstützung von Alex Krauer, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden von Ciba-Geigy, untersuchte ich in anderen Kulturen den Umgang mit dem Kreislauf von Nährstoffen. So verbrennen zum Beispiel die Yanomani-Indianer in Brasilien ihre Toten und rühren die Asche in Bananenbrei ein, den der Stamm dann bei einem rituellen Fest verspeist. Viele Menschen glauben an Karma und Reinkarnation, an ein »Upcycling« der Seele, wenn Sie so wollen. Diese Perspektiven erweiterten meinen Horizont und veränderten meinen Umgang mit dem Abfallproblem in der westlichen Tradition.
Aber es blieb schwierig, andere Chemiker zu finden, die an diesen Fragen &uu